Dem guten Übersetzer schenkt man ungefähr so viel Aufmerksamkeit wie einem gut geputzten Fenster, das ungetrübte Sicht ins Freie gewährt. Mit steigender Qualität unserer Arbeit sinkt unsere Sichtbarkeit. Gerade darum aber sollten wir, die literarischen Übersetzerinnen und Übersetzer, uns viel vehementer an die Brust schlagen: Ohne uns gäbe es schließlich keine Weltliteratur! So hat schon der portugiesische Literaturnobelpreisträger José Saramago gesagt: „Der Autor schafft mit seiner Sprache nationale Literatur, die Weltliteratur wird von Übersetzern gemacht.“ Das ist nun in der Tat eine ziemlich platte Plattitüde, aber ich betone sie gern immer wieder. Wir sind richtig wichtig! Wir tragen etwas bei. Zur Kultur, zum Leben.
Worin besteht nun die moralische Verpflichtung des literarischen Übersetzers? Wenn ich pathetisch geschwollen von ‚moralischer Verpflichtung‘ rede, lautet die Frage vorläufig, und immer noch schwammig formuliert, eigentlich: Haben literarische ÜbersetzerInnen einen kulturpolitischen Auftrag? Als erstes fällt einem vielleicht die ‚Reinerhaltung der deutschen Sprache‘ ein, aber das klingt ja schon fast faschistoid. Außerdem geht es auch oft genug vielmehr um eine Art ‚Unreinerhaltung‘, also darum, bisher von der Schrift- und Literatursprache ausgeschlossene Elemente wie Slang oder Umgangssprache literaturfähig zu machen, es geht um eine Erweiterung der Literatursprache. Als zweites denke ich an einen Aspekt, den man vielleicht ‚Sicherung von Menschheitsbüchern‘ nennen könnte: Ich möchte daran mitwirken, deutsche Leserinnen und Leser an Büchern teilhaben zu lassen, deren Stoffe, deren Figuren oder deren Stile ihnen etwas fürs Leben geben können, wie sie mir etwas geben müssen. Haben wir, eine Nummer kleiner gefragt, eine ethische Verantwortung? Eine tastende Erstantwort: Ja, wir müssen literarischen Figuren ihre Würde lassen. Ich möchte an einem Beispiel verdeutlichen, was ich damit meine. Vor einigen Jahren erschien eine Neuübersetzung von Mark Twains Huckleberry Finn, in der Nigger Jim folgendermaßen klang:
Ich also abgehau’n un’ ‘n Hügel runner un’ hab vor, mir irngwo an ‘n Ufe’ obe’halb vonne Stadt ‘n Skift zu klau’n, a’er da wa’n noch Leut z’gange, da ha’ ‘ch mich inner oll’n ein’e kracht’n Böttscherei an ‘n Ufe’ versteck’ un’ abg’wart’, dasse alle verschwin’n.[1]
Der Übersetzer lässt Flexionsformen weg – was für die Markierung einer Abweichung von der amerikanischen Standardsprache noch legitim wäre –, er elidiert aber auch auf unmotivierte, mir jedenfalls nicht nachvollziehbare Weise einzelne Buchstaben. Die daraus resultierende Stummelsprache ist meiner Meinung nach eine übersetzerische Todsünde. Jim, der bei Mark Twain ein deutliches Black American English spricht, wird in der Übersetzung ähnlich rassistisch markiert wie der schwarze Pirat in den Asterix-Comics, der kein ‚r‘ sprechen kann. Jim ist aber kein stammelnder Idiot, sondern wird im Verlauf der Floßfahrt den Mississippi runter zu Hucks großem Lehrer. Hucks soziale Optik verschiebt sich durch sein Zusammenleben mit Jim. Solange Huck bei der Witwe lebt, bestehen zwischen Jim und ihm als selbstverständlich hingenommene hierarchische Kommunikationsstrukturen: Nur weil er selber weiß ist, behandelt Huck Jim von oben herab und belehrt ihn. Im Verlauf der Floßfahrt merkt er aber, dass Jim weit mehr über die Welt weiß als er, er lernt zuzuhören, er lernt Toleranz, und am Ende seiner Gewissensprüfung ist er bereit, für Jim zur Hölle zu fahren. Diese Funktion Jims in einem der wichtigsten amerikanischen Romane des 19. Jahrhunderts muss der Übersetzer doch berücksichtigen, wenn er nach einem deutschen Pendant für Jims Sprachgebrauch sucht.
Es geht also um ‚Freiheit‘. Was heißt aber freies Übersetzen? Helga Frese-Resch, meine Lektorin bei Kiepenheuer & Witsch, sagte mal, die meisten sogenannten ‚Fehler‘ in Übersetzungen entstünden durch zu große Nähe zum Original; eine zu freie Übersetzung gäbe es praktisch gar nicht. Wenn ich ebenfalls dafür plädiere, so frei wie möglich zu übersetzen, gerate ich scheinbar in Widerspruch zu all jenen, die auf Genauigkeit gegenüber dem Original pochen. Der scheinbare Widerspruch löst sich aber schnell auf, wenn wir die Sache etwas genauer anschauen. Die vielbeschworene ‚Wirkungsäquivalenz‘ oder ‚Funktionskonstanz‘ ist ein großer Deckel, der auf viele Töpfe passt. Wichtig wird hier der Markt, für den die Übersetzung angefertigt wird. Wenn Susanne Lange den Don Quijote neu übersetzt, dann ist es ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit, sich die Wirkungsgeschichte des Romans im deutschen Sprachraum anzuschauen, die jeweiligen Übersetzungsstrategien ihrer Vorgänger Caesar, Bertuch, Tieck, Soltau und Braunfels zu analysieren und sich fast schon bei jedem Wort gegenwärtig zu halten, für welches heutige Publikum und in welches heutige Deutsch sie Cervantes’ barockes Spanisch übersetzt. Heerscharen von Kritikern schauen ihr über die Schultern, legen jedes ihrer Worte auf die Goldwaage und verdonnern sie zur philologischen Genauigkeit. Wenn ich dagegen einen sogenannten Schnelldreher für die gigantische Unterhaltungsliteraturmaschinerie des Bertelsmann-Konzerns übersetze, ein Ex-und-hopp-Buch, das nach drei Monaten vergessen ist, dann werde ich manchmal schon vom Lektorat aufgefordert, die Übersetzung für die Zielgruppe der deutschen Leser zu optimieren. Ich soll das Buch tendenziell umschreiben. Das Ergebnis soll einfach flutschen. In diesem Marktsegment der Unterhaltungsliteratur sind die Originale kaum mehr als das Rohmaterial, aus dem man deutsche Bücher macht. Eine Lektorin hat mir mal in vollem Ernst vorgeschlagen, siebzig Seiten eines Romans zu streichen, weil ihr ein Handlungsstrang des Buches nicht gefiel. An diesen Zynismus der Branche muss man sich gewöhnen. Ich sage das, wohlgemerkt, weder entrüstet noch resigniert, sondern zumindest teilweise affirmativ. Ich finde es völlig okay, wenn ein Buch der Unterhaltungsliteratur für ein anderes Land noch einmal einem gewissen Bearbeitungsprozess unterzogen wird, und habe mich an einer solchen Redaktion auch schon beteiligt. In Giles Fodens Roman Sansibar kommt beispielsweise eine Sekretärin morgens in ihre Firma und geht als erstes in die Teeküche. Und dann steht da im Original:
She went over to the coffee machine. After fetching out the jug from underneath, she crossed to the sink to pour away yesterday’s leftovers and fill it with water. Returning to the coffee machine, she tipped away the old grounds with their sodden skirt of paper and fixed a new filter. Then she opened a new foil packet of coffee with her teeth, shook its contents into the filter cone, poured the new water into the machine’s steel rap, and put the black jug underneath. The machine whirred. A green display said BREW. She stood for a moment, watching the first brown drops come through.[2]
Der Detailfetischismus hat hier meiner Ansicht nach keine erkennbare Funktion, er dient auch nicht der Spannungssteigerung durch Verzögerung, ergo bearbeitete ich die Passage. In der Übersetzung steht – nach Absprache mit dem Lektor – nur noch:
Sie ging zur Kaffeemaschine hinüber, kippte den abgestandenen Kaffee von gestern in den Ausguß und setzte neuen auf. Sie blieb stehen, bis die ersten braunen Tropfen aus dem Filter fielen.[3]
Welche Position ich in dem erwähnten Spannungsfeld von Wörtlichkeit und Freiheit einnehme, ist aber nicht nur eine Frage des Marktsegments, in dem die Übersetzung erscheint. Ich habe das Gefühl, dass viele Übersetzerinnen und Übersetzer oft zu zaghaft sind und sich auf die Bedeutungen beschränken, die uns die Wörterbücher anbieten. Dieses Stadium sollte man so schnell wie möglich hinter sich lassen und bei der Arbeit am Schreibtisch vom Deutschen her denken. Man kann doch ohne weiteres überlegen, was man in einer gegebenen Situation auf Deutsch sagen würde. Das schreibt man erst mal hin und schaut sich dann an, ob dieser Wortlaut dem, was im Original gemeint ist, nicht besser entspricht als das, was die Wörterbücher anbieten. Also in Anlehnung an Heinrich von Kleist gesagt, die ‚allmähliche Verfertigung der Übersetzung beim Reden‘. Nur dann schöpfe ich meiner Meinung nach die ganze Fülle meiner Muttersprache aus. Erst wenn sich in jedem Satz ein freier, kreativer Umgang mit dem Original ausdrückt, entsteht ein wahrhaft deutscher Text, der nicht mehr auf die Eins-zu-Eins-Beziehungen der Lexika reduzierbar ist. Auch die besten Wörterbücher erreichen nicht unser eigenes sprachliches Niveau. Auch ein enzyklopädisches Lexikon kann uns nur eine beschränkte Zahl an Fastsynonymen bieten. Aber wenn wir uns auf diese beschränken, verflacht die Literatur unter unseren Händen.
Eine große Crux selbst für erfahrene Übersetzer ist, dass auch deutsche Rezensentinnen und Rezensenten oft nur mit dem arbeiten, was ihnen die Wörterbücher anbieten, und dann Lösungen kritisieren, für die sich ein Übersetzer vielleicht erst nach langem Nachdenken und Abwägen der verschiedensten lexikalischen, syntaktischen, stilistischen und nicht zuletzt rhythmischen und lautlichen Alternativen entschieden hat. Die Folge ist, dass der abgewatschte Übersetzer in Zukunft auf Nummer Sicher geht. Gunhild Kübler, die Literaturkritikerin und Übersetzerin von Emily Dickinson, hat vor einigen Jahren in einem Essay genau diesen Aspekt aufgegriffen und gefragt:
Was bedeutet das aber für die Sprachentwicklung eines deutschen Lesepublikums, das so eifrig wie nie zuvor in der deutschen Lesegeschichte Literatur und Sachbücher in Übersetzungen konsumiert? Man kann sich’s ausmalen: Wir werden uns immer mehr an ein überkorrektes und schulmeisterliches, weil permanent schulgemeistertes Übersetzerdeutsch gewöhnen. Bis uns ein Deutsch mit Bügelfalten angemessen vorkommt.[4]
Wir sollten uns beim Übersetzen also nicht von der nörgelnden Beckmesserei nach dem Motto ‚Im Original steht doch aber ganz was anderes!‘ beeinflussen lassen. In Anlehnung an zwei Sätze aus Immanuel Kants berühmtem Essay Zur Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? könnte man auch sagen: „Habe den Mut, Dich Deiner Sprache ohne Leitung eines anderen zu bedienen.“ Wenn Sie das vollmundig von mir finden, dann liegen Sie richtig. Ich möchte auftrumpfen und uns dazu ermutigen, Sprache ähnlich selbstbewusst zu benutzen wie ein Schriftsteller. Arno Schmidt hat in einer Kurzgeschichte mal abschätzig geschrieben: „‚Leser‘, das sind diejenigen, die zeitlebens ‚Schirm‘ zu dem sagen, wobei einem Schriftsteller ‚ein Stock im Petticoat‘ einfällt!“[5] Ich plädiere dringend dafür, in diesem Satz den ‚Schriftsteller‘ durch ‚Übersetzer‘ zu ersetzen! Jeder gute Schriftsteller, aber eben auch jeder gute literarische Übersetzer ist ein Statthalter der deutschen Sprache. Er stemmt sich gegen die massenmediale Sprachverhunzung, das Ramschdeutsch im Internet und den allabendlich aus der Glotze quellenden Worthülsenfruchtsalat. Er stemmt sich gegen die Schändung der deutschen Sprache und versucht – nach dem Wort von Karl Kraus –, die Allerweltshure zur Jungfrau zu machen.[6] So, jetzt habe ich mit mehr oder weniger schicken Zitaten um mich geworfen und mich einigermaßen in Ekstase geschrieben. Außerdem war das alles viel zu abstrakt, also her mit ein paar Beispielen. Zunächst auf Wortebene: In Stephen Frys Roman The Hippopotamus bezeichnet der Erzähler Ted Wallace, ein früher gefeierter Lyriker und heute gefeuerter Kritiker, eine Wohnzimmereinrichtung als „the whole sham shambles“[7]. Übersetzt habe ich diese Wendung als „das ganze ausgelutschte Tohuwabohu“[8] und habe mir, ehrlich gesagt, nicht viel dabei gedacht. Ich erwähne das Beispiel an dieser Stelle, weil es einem Kritiker auffiel, der meinte, ich hätte ja auch schlicht von einem „faden Durcheinander“ sprechen können, und der damit illustrieren wollte, dass zwischen bloß korrekten und richtig kreativen Übersetzungslösungen ein weites Feld von legitimen Alternativen liegt. Ich wiederhole also mein Plädoyer, dass wir viel mehr über die Stränge schlagen und unserem Affen sprachlichen Zucker geben sollten.
Wenn man dabei das Gefühl hat, zu weit zu gehen, kann man sich ja mit seinem Lektor verständigen, wie ich es bei dem folgenden Beispiel aus dem Bereich der Syntax gemacht habe. Es geht um das leidige Problem der deutschen Verbalklammern. Ich möchte nun aber demonstrieren, dass man aus der Not der manchmal überdehnten deutschen Verbalklammern eine Tugend machen kann. Die sportliche Übung, möglichst viele Verbalklammern staccato-artig hintereinander zu schließen, ist in der deutschen Literatur sogar ein kleines Spiel unter Schriftstellern geworden. So schreibt Wolfgang Hildesheimer in seinen Mitteilungen an Max über den Stand der Dinge und anderes gleich im ersten Satz:
[A]llmählich wird mir dieser ewigwährende Zyklus ein wenig leid, wozu verschiedene Faktoren, deren Urheber ich in diesem Zusammenhang, um mich keinen Unannehmlichkeiten, deren Folgen, die in Kauf zu nehmen ich, der ich gern Frieden halte, gezwungen wäre, nicht absehbar wären, auszusetzen, nicht nennen möchte, beitragen.[9]
Das ist ein mit geradezu mathematischer Präzision gebastelter Satz – aber leider völlig unverständlich, wenn man ihn nicht schriftlich vor sich hat und aufdröseln kann, welches finite Verb nun welchen Nebensatz abschließt. Ich habe mir bei der Übersetzung von David Foster Wallace erlaubt, dieses Spiel mitzuspielen. Bei Wallace steht der Satz:
One must understand (as it was my original intention to attempt to explain to her stepfather) that though, as in any marriage, Hope and I had had our fair share of conflicts and difficult marital periods, the evident vehemence, anger and persecution with which she now dismissed my protests of being awake at the crucial junctures of alleged ‚snoring’ were unprecedented[10].
Dieser Satz ist komplex und zeichnet sich durch allerlei Hypotaxen aus, ist aber nicht auffälliger als andere hypotaktisch komplexe Konstruktionen bei Wallace. Die Übersetzung lautet:
Man müsse doch verstehen (wie ihrem Stiefvater erklären zu wollen meine ursprüngliche Absicht gewesen war), dass Hope und ich zwar wie jedes Ehepaar unser gerüttelt Maß an ehelichen Konflikten und schwierigen Zeiten hatten durchmachen müssen, jedoch seien die offenkundige Vehemenz, der Ärger und die Paranoia, mit denen sie jetzt all meine Darlegungen, ich hätte in den entscheidenden Augenblicken, in denen sie mir mein ‚Schnarchen’ unterstellte, wachgelegen, abtat, unerhört.[11]
Auch dieser Satz ist buchstäblich unlesbar, insofern er jeden Leser aus dem Lektürefluss schubst. Damit macht er aber etwas, das Wallace vielleicht nicht an dieser Stelle, sonst aber nur zu gerne macht: Er überfordert ganz bewusst seine Leser, oder aber er verarscht sie, auf Deutsch gesagt, denn an solchen Stellen soll der Leser ja merken, dass er auf die Schippe genommen wird. Er soll das Augenzwinkern des Autors sehen.
Um Sätze neu bauen und Wörter einfallsreich verwenden zu können, lautet die Frage nun aber: Wie erweitere ich meine Sprache? Ich persönlich lese auch deutsche Literatur grundsätzlich bleistiftbewaffnet und notiere mir unbekannte Wörter und Wendungen sowie rhetorisch auffällige Satzkonstruktionen. Die neuen Wörter schlage ich dann in unseren großen Wörterbüchern nach, um meinen deutschen Wortschatz ‚nach oben‘, also im literarischen Register zu erweitern. Ich notiere mir aber auch mit einem Bleistiftstummel, den ich immer in der Tasche habe, was mir in Alltagsgesprächen zufliegt, um meine Sprache ‚nach unten‘, im Substandardbereich der Umgangssprache zu erweitern. Ich huldige ganz allgemein dem Wortsammelfetischismus, wie unser Kollege Frank Heibert diese déformation professionelle mal nannte. Man könnte auch sagen: Aufs Maul schauen 2.0! Die Literatur wird es uns danken. Die Leser übrigens auch.
—
Ulrich Blumenbach, geb. 1964 in Hannover, hat Anglistik und Germanistik in Münster, Sheffield und Berlin studiert, arbeitet seit 1993 als literarischer Übersetzer aus dem Englischen und Amerikanischen und hat Romane, Essays und Erzählungen von Paul Beatty, Agatha Christie, Giles Foden, Stephen Fry, Arthur Miller und David Foster Wallace ins Deutsche gebracht. Gegenwärtig arbeitet er an David Foster Wallace’ Nachlassroman The Pale King.
Der vorliegende Text ist die leicht gekürzte und überarbeitete Fassung eines Vortrags, den der Verfasser am 3. August 2010 im Rahmen der Summer School des Studiengangs Literaturübersetzen an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gehalten hat.
[1] Mark Twain, Abenteuer von Huckleberry Finn, neu übersetzt von Friedhelm Rathjen, Zürich: Haffmans 1997: 78.
[2] Giles Foden, Zanzibar, London: Faber & Faber 2002: 242 f.
[3] Ders., Sansibar, Berlin: Aufbau 2003: 272.
[4] Gunhild Kübler, „Deutsch mit Bügelfalten“, Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, 5.1.2003: 50. Erneut in: Sprache im technischen Zeitalter 41 (2003), Nr. 166: 194-198.
[5] Arno Schmidt, „Nebenmond und rosa Augen“, 63-71 in: Ders., Sommermeteor. 23 Kurzgeschichten, Frankfurt / Main: S. Fischer 1969: 64 f.
[6] „Meine Sprache ist die Allerweltshure, die ich zur Jungfrau mache.“ Karl Kraus, Die Fackel 326-328 (8. Juli 1911): 45.
[7] Stephen Fry, The Hippopotamus, London: Hutchinson 1994: 13.
[8] Stephen Fry, Das Nilpferd, Zürich: Haffmans 1994: 30.
[9] Wolfgang Hildesheimer, Mitteilungen an Max über den Stand der Dinge und anderes, Frankfurt / Main: Suhrkamp 1983: 7.
[10] David Foster Wallace, “Oblivion”, 190-237 in: Ders., Oblivion, New York / Boston: Little, Brown and Company, 2003: 202.
[11] Ders., „Vergessenheit“, 19-89 in: Ders. Vergessenheit, Köln: Kiepenheuer & Witsch 2008: 37.

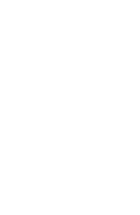
Rein zufällig kam ich auf meiner Internetreise durch den Literaturdschungel auf dieses richtig wohltuende Plädoyer für die sprachliche Eigenständigkeit des Übersetzers. Das – im Wortsinn: vollmundige – Pochen auf die dem Muttersprachler eigene Ausdruckskraft bei der Übertragung fremdsprachlicher Texte wäre übrigens häufig auch bei den so genannten Fachtexten am Platz! Geradezu devote, wörtliche Übersetzungen begegnen mir als Fachübersetzerin auch viel zu oft bei juristischen Texten in der Übersetzung vom Englischen ins Deutsche. Die nicht auszurottende Wendung „unter anderem einschliesslich“ („including, and not limited to“) ist dort das Wenigste. Klar, dass sich Fachbegriffe meist weniger für Kreativität eignen als belletristische Befindlichkeiten, aber auch ein „technischer Text“ sollte so spannend wie möglich und darüber hinaus – elementar, aber wichtig! – so verständlich wie möglich sein. In diesem Sinn würde ich im deutschen Wallace-Satz Beispiel von Ulrich Blumenbach in der Klammer vielleicht doch eher formulieren „… (wie ich ihrem Schwiegervater ursprünglich erklären wollte/zu erklären beabsichtigte)… Auf dass die Knitterfalten im restlichen Text dann um so mehr zur Geltung kommen!