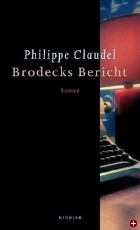Wirklich, Brodeck lebt in finsteren Zeiten!
Zeiten, in denen der Lauf des Lebens von Nichtigkeiten abhängt: „[…] ob man den einen oder den anderen Weg einschlägt, ob man einem Schatten folgt oder vor ihm flieht, ob man eine Amsel erschießt oder sie am Leben lässt.“ Oder von einem Stück Butter. An dieses kleine Stück Butter zum Keksebacken, das an jenem Abend in der Speisekammer fehlte, hat Brodeck seitdem oft denken müssen. Denn so kam es, dass er das Wirtshaus „Schloss“ betrat. Und so kam es, dass er dort auf die Dorfgemeinschaft traf, die soeben gemeinschaftlich den Anderen ermordet hatte. Und so kommt es, dass Brodeck den Bericht verfassen muss.
Da Brodeck als Einziger im Dorf eine Schreibmaschine besitzt, beauftragen die Dörfler ihn, die Ereignisse, die zur Ermordung des Anderen geführt haben, darzulegen. Parallel zu dieser Verteidigungsschrift beginnt Brodeck im Geheimen mit der Niederschrift eines zweiten Berichts: einer Bestandsaufnahme seines Lebens sowie jenes Jahrhunderts, das Biografien wie seine zuhauf hervorbrachte. Sein Bericht erzählt von den Schrecken und Abgründen jener Jahre – von Flucht, Deportation und Lager, von Schuld, Hass und Angst.
Er beschreibt, wie er als vierjährige Waise auf der Flucht aus den Trümmern seines Heimatortes in dem Bergdorf ein neues Zuhause findet. Wie er zum Studium in die Hauptstadt S. geht, aus der er nach der Pürischen Nacht wieder flieht. Wie die Fratergekeime das Dorf besetzen, die Dorfgemeinschaft ihn verrät und er deportiert wird. Er berichtet, wie er im Zug ins Kazerskwir einer Mutter mit Kind den letzten Schluck lebensrettenden Wassers stiehlt und im Lager auf die Seelenfresserin trifft. Wie er nach langem Marsch in das Dorf zurückkehrt, wo nach dem Krieg alles normal zu sein scheint, und es doch ganz und gar nicht ist. Und wie der Andere diese fragile Nachkriegsnormalität zerstört und deswegen sterben muss.
Der Andere ist kurz nach Kriegsende in das abgeschiedene Bergdorf gekommen, und zusammen mit seinem Pferd Monsieur Socrate und der Eselin Madame Julie bietet er einen merkwürdigen Anblick: „Er sah aus, als käme er aus einer anderen Zeit. Ich konnte es nicht fassen, eine richtige Schießbudenfigur, jedenfalls zieht man sich doch heute nicht mehr so an. Er trappelte mit seinen beiden Zirkustieren die Straße entlang, als wäre er unterwegs zu einer Revue oder einem Puppentheater.“ Er sieht anders aus, spricht anders, ist anders. Und obwohl die Dörfler ihn meiden wie der Teufel das Weihwasser, scheint er doch all ihre Geheimnisse zu kennen. Sie befürchten nun, dass ihre Taten durch ihn ans Licht kommen und beschließen, den Anderen zu töten. „Das musste ja so enden, Brodeck. Dieser Mann war wie ein Spiegel, verstehst du, er sagte nichts, man sah nur sich selbst in ihm. […] Und Spiegel, Brodeck, müssen brechen, früher oder später.“
Philippe Claudels Roman ist weder zeitlich noch räumlich eindeutig zu verorten – wenngleich der Text einige Interpretationen zulässt. Der Zerfall Österreich-Ungarns und der 1. Weltkrieg, der Holocaust und der 2. Weltkrieg, Guantánamo und Enduring Freedom… Vieles wäre darin zu sehen. Diese Deutungsfreiheit unterstreicht den parabelhaften Charakter des Romans und zeigt: Brodecks Bericht gilt überall, wo Angst vor dem Fremden das Denken und Handeln bestimmt. „Nicht weil sie mich hassten, sondern weil sie Angst hatten, war ich zum Opfer geworden. Weil gewissen Leuten die Angst im Nacken gesessen hatte, war ich den Henkern ausgeliefert worden, und auch die Henker, Männer, die einst gewesen waren wie ich, hatte die Angst zu solchen Ungeheuern gemacht und den Keim des Bösen, den sie, wie wir alle, in sich trugen, sprießen lassen.“
Dabei verwendet Claudel eine Sprache, die höchst reflektiert und zugleich aphoristisch verknappt ist. Kein Leichtes für die Übersetzung, verlangt dies im Deutschen doch größtes Einfühlungs- sowie Stilvermögen. Doch Christiane Seiler, Claudels mit dem André-Gide-Preis ausgezeichnete Stammübersetzerin, wird dieser Herausforderung in einer hervorragenden Übersetzung vollkommen gerecht. Ihr Können offenbart sich vor allem in so kunstvollen Destillaten des Claudelschen Stils wie diesem: „[…] être seul pour certains ne peut conduire qu´à d’étranges ruminations, des échafaudages tortueux et bancals. Et à ce jeu-là, j’en connais beaucoup qui parviennent en quelques soirées d’hiver à se révéler de drôles d’architectes.“ Im deutschen Text wurde daraus: „Die Menschen sind so einsam hier, dass sie in quälendes Grübeln geraten und sich seltsame, wackelige Gedankengebäude zurechtzimmern. An langen Winterabenden werden viele zu seltsamen Baumeistern.“
Auch wenn Philippe Claudel in Interviews stets betont, mit seinem Roman auf kein bestimmtes Ereignis, auf keine bestimmte Zeit und auf kein bestimmtes Land anspielen zu wollen, erinnert der Dialekt der Dörfler, eine Art Französisch mit alemannischem Einschlag, ans Elsässische. Die Sprache eines Gebiets, das, mal deutsch, mal französisch, über die Jahrhunderte hinweg veranschaulicht, dass Grenzen nichts weiter als von Menschenhand gezogene Striche auf der Landkarte sind. Und nirgendwo sonst als in solchen Grenzregionen sind die Fragen nach der eigenen Identität und „dem Anderen“ derart akut. In Brodecks Bericht erfolgt Zugehörigkeit und Ausgrenzung über die Sprache. Schon mit den ersten Worten des Anderen ist klar, dass es kein gutes Ende mit ihm nehmen kann – er spricht die Sprache des Landesinneren, nicht den Dialekt der Region. „Und obwohl sie [die Fratergekeime] aus einem anderen Land kamen, waren sie den Bewohnern unserer Gegend sehr ähnlich. Die Menschen hier fühlen sich im Grunde ihrem Vaterland nicht zugehörig. Das Vaterland war für sie wie eine Frau, die sich von Zeit zu Zeit mit einem zärtlichen Brief oder einer kleinen Bitte in Erinnerung rief, deren Antlitz sie aber nie zu Gesicht bekamen. Die Soldaten, die als Sieger bei uns eintrafen, hatten die gleichen Bräuche wie wir und sprachen eine Sprache, die der unseren so ähnlich war, dass wir uns kaum anstrengen mussten, wenn wir sie verstehen wollten.“
Doch hierin tut sich ein Übersetzungsproblem auf. Der Dialekt der Dörfler mutet zwar Elsässisch an, er ist es aber nicht. Vielmehr handelt es sich um eine Kunstsprache, die in Klang und Schreibung ans Deutsche angelehnt zu sein scheint. Dies ist wohl kaum ein Zufall, sondern eher historischer Intertext. Zudem muss auch die Divergenz zwischen dem dörfischen Dialekt und der Sprache des Anderen, zwischen Kunstsprache und Hochsprache, zwischen Zugehörigkeit und Fremdheit zum Ausdruck kommen. Doch wie handhabt man dies in der deutschen Übersetzung? In seiner Rezension zu Brodecks Bericht auf dem Internetportal der FAZ schreibt Joseph Hanimann: „Kam den Franzosen das Unheimliche in diesem Buch durch die zahlreich eingefügten Originalwörter im Fremdklang eines alemannisch anmutenden Lokaldialekts entgegen, so liegt es dem deutschen Publikum sprachlich beinah allzu vertraut im Ohr. Das liegt nicht an der Übersetzung, sondern an der Natur der Sache.“[1]
Es liegt dem deutschen Publikum nicht „beinah allzu vertraut im Ohr“, es ist ihm absolut vertraut – denn es ist Deutsch. Claudels Kunstsprache wurde durch eine reale Sprache ersetzt, sie wurde übersetzt. Das liegt keineswegs „an der Natur der Sache“, sondern ist eine Entscheidung der Übersetzerin bzw. des Verlages. Im Zuge dieses eindeutschenden Übersetzungsstils geht dem Roman der Originalton des dörfischen Dialekts verloren: „Ne me demandez pas son nom, on ne l’a jamais su. Très vite les gens l’ont appelé avec des expressions inventées de toutes pièces dans le dialecte et que je traduis : Vollaugä – Yeux pleins – en raison de son regard qui sortait un peu du visage; de Murmelnër – le Murmurant – car il parlait très peu et toujours d’une petite voix qu’on aurait dit un souffle; Mondlich – Lunaire – à cause de son air d’être chez nous tout en n’y étant pas; Gekamdörhin – celui qui est venu de là-bas.“ Christiane Seilers Brodeck sinniert dagegen schlicht: „Fragen Sie mich nicht, wie er hieß, das weiß niemand. Bald hatten die Leute irgendwelche Namen für ihn gefunden, die sie in ihrem Dialekt aussprachen: Vollauge – weil seine Augen etwas hervortraten; Murmelnder – weil er wenig und wenn, dann nur leise, fast flüsternd, sprach; Mondmensch – weil er zwar hier bei uns lebte, aber doch nicht zu uns gehörte; Hergekommener – weil er nicht von hier war.“
Es muss ja nicht – wie in der französischen Filmkomödie Willkommen bei den Sch’tis – ein deutsches Äquivalent zum französischen Dialekt erschaffen werden. Dennoch drängt sich die Frage auf, weshalb die Übersetzerin diese Eigenart des Textes nicht übernommen und die kunstsprachlichen Wendungen beibehalten hat. Schließlich wurde aus den von Claudel erdachten Begriffen Fratergekeime und Kazerskwir in der Übersetzung ja auch nicht „Besatzer“ und „Konzentrationslager“. Dabei ist dieses Begriffspaar für den Roman nicht stilprägender als die restlichen Einsprengsel in Claudels Kunstsprache, die Christiane Seiler in gänzlich unmarkiertem Deutsch übersetzt hat.
Doch Brodecks Bericht lebt von weit mehr als der eigens für ihn geschaffenen Kunstsprache. In Frankreich nennt man ihn in einem Atemzug mit den großen Kriegsromanen wie Michel Tourniers Der Erlkönig oder Jonathan Littells Die Wohlgesinnten. Und wenn es nach der wunderbaren Übersetzung von Christiane Seiler geht, steht diesem Erfolg auch in Deutschland nichts im Wege.
Philippe Claudel: Brodecks Bericht, übersetzt von Christiane Seiler, Reinbek bei Hamburg: Kindler 2009, 332 Seiten, 19,90 €
Philippe Claudel: Le rapport de Brodeck, Paris: Stock (Le livre de poche) 2007, 374 Seiten, 6,95 €
Philippe Claudel wurde 1962 in Dombasle-sur-Meurthe (Lothringen) geboren. Neben seiner Lehrtätigkeit an der Université de Nancy arbeitet er als Dramatiker, Regisseur und Schriftsteller. Seine Werke wie Die grauen Seelen oder Monsieur Linh und die Gabe der Hoffnung wurden mehrfach ausgezeichnet und in mehrere Sprachen übersetzt. Für Brodecks Bericht erhielt er 2007 u.a. den renommierten Prix Goncourt des Lycéens.
Christiane Seiler wurde 1961 geboren. Nach einer Ausbildung zur Tontechnikerin studierte sie Literaturwissenschaft, Religionswissenschaft und Ethnologie in Berlin und Paris. Seit 1993 arbeitet sie in Berlin als freie Übersetzerin aus dem Englischen und Französischen und als Rundfunkautorin. Für die Übersetzung von Richard Millets L’amour des trois soeurs Piale (dt. Die drei Schwestern Piale) erhielt sie 2000 den renommierten André-Gide-Preis. Sie ist die Übersetzerin aller bisher von Philippe Claudel in Deutschland erschienenen Romane und Erzählungen.
Silke Pfeiffer studiert seit 2006 Literaturübersetzen an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf mit den Sprachen Englisch und Französisch. Das Wintersemester 2008/09 verbrachte sie in Besançon und Lyon.
[1] Joseph Hanimann: Erlkönig wohnt unter uns, FAZ.net, 01.08.2009