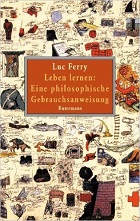Viermal P ist Luc Ferry: Philosoph, Professor, Publizist und Politiker. Und in allen diesen Eigenschaften hat er auf knapp 300 Seiten zusammengefasst, „was er in der Geschichte des Denkens als wichtig erachtet“. Und zwar „weil man ohne die Philosophie nichts von der Welt verstehen kann, in der wir leben“. Sein Buch stand seit dem Erscheinen beim Verlag Plon 2006 in Frankreich monatelang auf der Bestsellerliste, bekam quasi postwendend den Prix Aujourd’hui verliehen – eine Auszeichnung für ein historisches oder politisches Werk, das sich mit der aktuellen Gesellschaft befasst – und wurde von der französischen Literaturkritik in den höchsten Tönen gelobt. Im März ist die „philosophische Gebrauchsanweisung“ nun in Lis Künzlis Übersetzung bei Kunstmann erschienen – doch die Welle der Begeisterung scheint hierzulande so hoch nicht zu schlagen. Woran liegt’s?
Vielleicht am Tempo. Ferry möchte laut eigener Aussage im Vorwort „eine Einführung vorlegen, die so lesbar wie möglich ist, aber ohne dass Reichtum und Tiefe der philosophischen Vorstellungen darunter leiden“. Und dann rast der Autor in den vier „wichtigsten Schritten“ im Schweinsgalopp vom Stoizismus über das Christentum dem Humanismus entgegen, umkreist noch schnell den „Fall Nietzsche“ in der Postmoderne und kommt über die ‚zeitgenössische‘ Philosophie nach der Dekonstruktion (wobei Heidegger der modernste Vertreter ist) schließlich zu seinem eigenen philosophischen Gesamtkonstrukt. Das dann übrigens erstaunlich banal ist: Man solle doch bitte schön tolerant sein und die anderen respektieren. Schön und gut. Der „Reichtum und die Tiefe der philosophischen Vorstellungen“ kommen hier nicht an: Dafür geht’s dem Leser ohne Philosophiestudium oder gründliches philosophisches Vorwissen nicht nur zu schnell, sondern es wird auch zu viel gefachsimpelt. „Insofern ist der göttliche Charakter der Welt, wie du siehst, gleichzeitig immanent und transzendent“ lautet beispielsweise Ferrys Fazit zur „Theoria“ des Stoizismus. Alles klar, vielen Dank.
Vielleicht liegt’s auch an der Methode. Das französische Buch ist rein optisch und logisch wesentlich leserfreundlicher gestaltet als das deutsche: Die Fußnoten z. B. befinden sich in der französischen Ausgabe im unteren Seitenabschnitt, in der deutschen Ausgabe dagegen am Ende des Buches. Zum Teil handelt es sich jedoch um recht ausführliche und für das Verständnis unerlässliche Fußnoten, und der Lesefluss wird durch das ständige Blättern enorm beeinträchtigt. Auch das Inhaltsverzeichnis ist – in der deutschen Praxis sonst eher nicht üblich – dem Text nachgestellt, sodass es nicht ohne Weiteres eine grobe Orientierung im Vorhinein gibt. Die Zitate sind sowohl im französischen als auch im deutschen Text häufig nicht belegt oder ihre Quellen werden nicht angeführt. Zudem hat der Autor nicht angegeben, welche Bibelübersetzung er verwendet – obwohl ein ganzes Kapitel sich mit dem Themenkomplex „Christentum und Philosophie“ beschäftigt und die Bibel sehr häufig zitiert wird. Auch ist die Bibel weder im deutschen noch im französischen Literaturverzeichnis zu finden. Insgesamt entsteht dadurch ein Eindruck von Lückenhaftigkeit und schlechter Recherche.
Vielleicht liegt’s also auch an der Attitüde. Ferrys Buch ist aus einem spontanen Ferien-Philosophiekurs für Eltern und Kinder hervorgegangen und richtet sich an einen „gleichzeitig realen und idealen Schüler, der an der Schwelle zum Erwachsenenalter steht, sich aber noch nicht ganz von der Welt der Kindheit verabschiedet hat“. Darum wird der Leser geduzt: „Man möge darin keine Anbiederung sehen, sondern einen Ausdruck der Freundschaft oder Sympathie.“ Nun ja. Im Französischen mag das funktionieren: Dort wird viel häufiger gesiezt. Die normale (Leser-) Anrede ist dort immer die Sie-Form, das Du entsprechend schon sehr intim oder eben wesentlich jüngeren Gesprächspartnern vorbehalten. Auch der französische Titel macht deutlich, dass es sich bei Ferrys Studie in erster Linie um ein Lehrbuch für Jugendliche handelt: Traité de philosophie à l’usage des jeunes générations, ‚philosophische Abhandlung für Jugendliche‘. Der vom Verlag vorgegebene deutsche Titel Leben lernen. Eine philosophische Gebrauchsanweisung ist dagegen irreführend. Hier fühlt sich eine andere Art Leser angesprochen: Erwachsene, die lernen wollen, ihr Leben zu meistern, Sinnsucher, vielleicht Intellektuelle. Das aufgezwungene Du, die manchmal arg herablassend anmutende Haltung des Autors („Was lernen wir daraus?“, „Wir halten also fest“, „Ich möchte, dass du dir folgendes merkst“) oder auch die direkten Referenzen auf die Welt eines jugendlichen Lesers („Stell dir vor, dein neuer MP3-Player …“) stören einen solchen Leser eher, statt ihn für den Autor einzunehmen.
Auch der gewollt mündliche Stil trägt wohl seinen Teil dazu bei. Denn es kommt manchmal zu ungewollt komisch wirkenden Stilbrüchen, wie auch die Übersetzerin Lis Künzli bemerkte, als sie von mir zu ihrer Einschätzung der „Philosophischen Gebrauchsanweisung“ Luc Ferrys befragt wurde: Sie hält das Buch völlig zutreffend für „eine Mogelpackung, da er sagt, er schreibt es für junge Leser, dann aber halbe Kapitel aus früheren Büchern übernimmt, die eher für ein Fachpublikum bestimmt waren. Das geht natürlich stilistisch nicht immer ohne Brüche ab.“
Im französischen Original sind diese Stilbrüche tatsächlich noch stärker wahrzunehmen als in der Übersetzung, denn Lis Künzli nähert zwei völlig unterschiedliche Stilebenen behutsam einander an und schafft dadurch einen wesentlich kohärenteren deutschen Text. So übersetzt sie zum Beispiel „a priori“ konsequent mit „von vornherein“, „a fortiori“ mit „erst recht“, „ipso facto“ mit „zwangsläufig“, „perfectibilité“ mit „Vervollkommnungsfähigkeit“ oder „doctrine“ mit „Heilslehre“ und überträgt zudem den im Französischen sehr gewollt wirkenden mündlichen Stil leichthändig und ungezwungen ins Deutsche, ohne zu dick aufzutragen: aus „tout fout le camp“ wird „alles geht den Bach runter“, „grand bien leur fasse“ wird zu „wenn sie nichts Besseres zu tun haben“, „salauds“ zu „Dreckskerlen“ usw. Leider unterlaufen ihr dabei allerdings manchmal kleinere Inkonsistenzen: „scienticisme“ zum Beispiel wird einmal als „Wissenschaftsgläubigkeit“ und einmal mit dem im Deutschen sehr prätentiösen Wort „Szientizismus“ übersetzt, „animalité“ einmal als „Tierreich“ und einmal als „Animalität“, desgleichen „idoles“ einmal als „Götzen“ und einmal als „Idole“, obwohl es hier um denselben Kontext, nämlich Nietzsche, geht. Das ist schade, denn der deutsche Text wirkt im Allgemeinen viel natürlicher und runder als der französische, und diese kleinen Unaufmerksamkeiten fallen dadurch umso mehr auf.
Vielleicht ist Ferrys Buch auch einfach zu französisch für den deutschen Buchmarkt. Denn die tiefe Verankerung des Autors in seinem eigenen Kulturkontext zeigt sich sehr oft im Text: er spricht von 1789 als Referenzpunkt, von „notre histoire“ (unserer Geschichte) und „la France d’aujourd’hui“ (dem heutigen Frankreich), der französischen kolonialen Vergangenheit, Rimbaud mit seinem trunkenen Schiff, Mai 1968, Baudelaires Albatros, dem CNRS (Centre national de recherche scientifique) und Streiktagen, um seine Ausführungen an Beispielen zu erklären. Die Übersetzerin übernimmt diese natürlich – doch so entfernt sich der Text noch weiter vom deutschen Leser: Nicht nur die Altersbarriere und die Stilbarriere müssen also überwunden werden, sondern außerdem eine Kulturbarriere.
Und nicht zuletzt auch eine Sprachbarriere: Ein sich immer wiederholendes Wortspiel, welches das Wesen der Philosophie als Zusammenhang zwischen Liebe und Erkenntnis erklärt, funktioniert im Deutschen einfach nicht: „Dans la Bible, connaître veut dire aimer.“ / „In der Bibel heißt erkennen gleichzeitig auch lieben.“ Die Erklärung im französischen Original Luc Ferrys ist: „‚Il la connut bibliquement‘ signifie ‚il a fait l’amour avec elle‘“. Auf Deutsch: „‚Er hat sie biblisch erkannt‘ bedeutet ‚er hat mit ihr geschlafen‘“. Der tiefe Zusammenhang zwischen „erkennen“ und „lieben“ und die daraus folgende Erklärung der Philosophie als Liebe zur Weisheit, also als Erkenntnis, sind im Deutschen eben so wenig selbst-verständlich wie Ferrys eigenes philosophisches Konzept der Erkenntnis als Liebe und vice versa. Darum erscheint insbesondere das Ende gewollt und konstruiert, während es im Französischen zwar auch banal, doch wenigstens logisch ist.
Und so zeigt sich wieder einmal: Übersetzen bedeutet unendlich viel mehr als nur Übertragen. Die vierfache Barriere des Alters, des Stils, der Kultur und der Sprache muss hier überwunden werden – doch gegen diese vier Bs kommt selbst der vierfache P nicht an.
—
Luc Ferry: Leben lernen: Eine philosophische Gebrauchsanweisung, aus dem Französischen übersetzt von Lis Künzli, München: Antje Kunstmann 2007, 320 Seiten, €19,90
Luc Ferry: Apprendre à vivre. Traité de philosophie à l’usage de jeunes générations, Paris: Plon 2006, 302 Seiten
Luc Ferry, geboren 1951, hat Philosophie und Politikwissenschaften studiert und als Universitätsprofessor an verschiedenen französischen Universitäten gelehrt. Von 2002 bis 2004 war er Erziehungsminister in Frankreich. Für seine über zwanzig Publikationen wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. dem Prix Médicis, dem Prix Jean-Jacques Rousseau und dem Prix Aujourd’hui. Seine Bücher sind in 25 Sprachen übersetzt.
Lis Künzli ist 1958 in der Schweiz geboren, hat Germanistik, Philosophie und Komparatistik in Zürich, Aix-en-Provence und Berlin studiert und ist nach mehrjähriger Tätigkeit als Lehrerin an verschiedenen Schulen zum Literaturübersetzen gekommen. Ihre Hauptgebiete sind Belletristik sowie Geistes- und Humanwissenschaften.