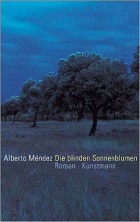Den Krieg erlebt jeder Mensch allein. Seine Geschichte jedoch ist verflochten mit den Geschichten anderer. Alberto Méndez bildet dieses Geflecht ab und erzählt vier Geschichten, die sich an verschiedenen Punkten wie beiläufig berühren.
Für die erste Geschichte dieses vierteiligen Buches hat sich der Autor selbst die Fesseln des nüchternen Berichts auferlegt. Distanziert und formell ist seine Sprache und entspricht so der Haltung des Hauptmanns Alegría, als dieser sich dem Gegner ergibt. Er legt Wert darauf, zu unterscheiden, will nicht sagen „me rindo“, sondern „Soy un rendido“, und verdeutlicht damit, dass seine Kapitulation bereits stattgefunden hat, bevor er sich ergibt. Angelica Ammar hat übersetzt „ich ergebe mich“ und „Ich bin ein Kapitulierender“, so dass man auch beim Lesen der Übersetzung die Kluft erahnt, die zwischen diesen Worten liegt.
Das für diesen Teil leitmotivische „luchar“ beziehungsweise „morir por usura“ übersetzt sie mit dem Wort „Abnutzungsschlacht“, das auf die technisch-brutale Dimension des Krieges weist. In der „Abnutzungsschlacht“ klingt die militärisch gefärbte Sprache des ersten Teils an, die sich teilweise etwas sperrig liest, in der Übersetzung mehr noch als im Original. Im Spanischen klingen Befehle wie „Pelotón…Apunten…Fuego“ hart und zielsicher wie die ihnen folgenden Schüsse, im Deutschen dagegen etwas umständlich: „Erschießungskommando…Legt an…Feuer“. Eher erklärend als lautmalerisch zeigt sich hier die deutsche Sprache. Im Original kontrastieren die Mutmaßungen des erzählenden Chronisten über die Gedanken und Gefühle Alegrías mit der kalten Sprache des Kriegsgeschäfts. In der Übersetzung irritiert die nüchterne Sprache, als habe man sich zu ihrem Gebrauch nicht richtig entschließen können. Doch spiegelt nicht gerade diese sprachliche Unentschlossenheit den Zwiespalt des Hauptmanns wider, der schließlich untergeht, ohne auch nur einen moralischen Sieg errungen zu haben?
Weil er mit flammenden Pamphleten und glühenden Gedichten gegen die Faschisten das kollektive Schweigen durchbrochen hat, muss der junge Dichter Eulalio Ceballos Suárez mit seiner schwangeren Frau in die Berge flüchten. Sein Tagebuch, von einem anderen Erzähler als in der ersten Geschichte kommentiert, bildet den zweiten Teil des Buches. Sein Schreiben ist ein geistiger Überlebenskampf, eine unermüdliche Wortproduktion, um nicht dem Wahn zu verfallen in der Einsamkeit. Es hat keine Dichte, es erzählt nichts, beschreibt aber auch nicht, sondern ist ein Abbild der Leere, des stummen Vergehens und stumpfen Siechtums des Dichters, das sich im Gestank des Todes vollzieht (denn seine junge Frau stirbt bei der Geburt ihres Kindes und ihm fehlt der Wille, das Neugeborene am Leben zu halten). Hilflos kreist der Text um den Tod und die Liebe, und man hat den Eindruck, als habe der Dichter nicht genug Lebenszeit gehabt, diese Begriffe zu fassen, die ihn so massiv überrannten.
„El idioma de los muertos“ nennt Méndez die dritte Geschichte, in welcher der Gefangene Juan Senra sich ebendieser „Sprache der Toten“ bemächtigt: Vor dem Tribunal berichtet er von einer Begegnung mit dem mittlerweile von Republikanern hingerichteten Sohn des vorsitzenden Oberst, und das rettet ihm zunächst das Leben. Es sind Lügengeschichten, die sein Leben verlängern. Auch hier ist es also Sprache, die das Überleben sichert. Nun kommt es darauf an, möglichst ausführlich, möglichst überzeugend zu erzählen, und so gerät auch die Erzählung selbst in Fluss. Die in diesem Teil zuweilen noch etwas bemüht erscheinende Bildhaftigkeit, die vor allem in den Briefen des Gefangenen an seinen Bruder zutage tritt, in denen jener seine Träume von einer anderen (Sprach-)Welt beschwört, weicht einem flüssigen, fesselnden Erzählstil im vierten, letzten Teil des Bandes.
Brieflich legt hier ein Diakon die Beichte ab. Er schreibt sich dabei um Kopf und Kragen, und obwohl er fast nichts auslässt, ist diese Ehrlichkeit doch nur die halbe Wahrheit. Daher wird sein Salbader (ähnlich schmierig wie das spanische „untuoso“) ergänzt durch die Perspektive eines Jungen, in dessen Familie er sich allzu selbstgerecht und gierig und schließlich todbringend einmischt. Hier stehen sich spannungsvoll zwei Sprachhaltungen gegenüber: Die eine scheinbar alles sagende, doch das Wesentliche verleugnende Sprache, die den Gebrauch altmodischer, schnörkeliger Wörter wie „bar“ im Sinne von ‚ohne‘ für „sin“ und für das wiederholte „¡Ay de mí!“ einmal ein selbstmitleidiges „ich Elender“, an anderer Stelle aber auch das leicht antiquierte „Weh mir!“ rechtfertigt, die andere, aufrechte Sprache, die in schlichten Worten die ganze Traurigkeit umfasst, die ein Kind umgibt, das seine Familie mit seinem Schweigen schützen muss.
Die Übersetzerin folgt geschmeidig den wechselnden Stilen des Autors. Sie vermeidet im ersten und zweiten Teil, wo es doch einerseits auf die widerspenstige, trockene, andererseits auf die unfertige, sich noch suchende poetische Sprache ankommt, verführerische ‚Verbesserungen‘. Sie lässt sich aber auch in den erzählenden Passagen des dritten und vierten Teils nicht dazu hinreißen, der Sprache des Autors ihre eigene überzustülpen.
Schweigen durchzieht dieses Buch, und es ist schwer, über das Schweigen zu sprechen, weil man damit seinen Bann bricht. Dank der Übersetzung, die auch das Nichtgesagte erfasst, kann der Leser dem Ringen des Autors um die hinter dem Schweigen verborgenen Wörter folgen.
—
Alberto Méndez: Die blinden Sonnenblumen, aus dem Spanischen übersetzt von Angelica Ammar. München: Kunstmann 2005, 192 Seiten
Alberto Méndez: Los girasoles ciegos. Barcelona: Anagrama 2004, 155 Seiten
Alberto Méndez wurde 1941 in Madrid geboren und starb dort 2004. Er kämpfte im Widerstand gegen die Diktatur Francos. Er arbeitete als Verleger. „Los girasoles ciegos“ ist sein einziges Buch.
Angelica Ammar ist Autorin und Übersetzerin aus dem Französischen und Spanischen. Übersetzt hat sie unter anderem Werke von Felisberto Hernández, Gioconda Belli und Arturo Pérez-Reverte.