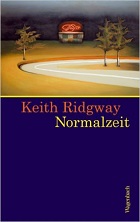Wir begegnen einem irischen Autor. Einem, der mehr erzählt als die Geschichte seiner Kindheit in herzergreifender Detailfülle; der Einblicke gewährt in das Leben und die Köpfe von Menschen, die unterschiedlicher kaum sein könnten und die doch alle etwas gemeinsam haben. Keith Ridgways Normalzeit ist eine schöne Sammlung irritierend anderer Kurzgeschichten – sie berichten von Zweifeln, Visionen, von Grenzgängen und merkwürdigen Zufällen und decken die Makel menschlichen Verhaltens auf, ohne zu moralisieren. Es sind Geschichten, in denen Vernunft keine Rolle spielt.
Zwölf Einblicke, zwölf Geschichten präsentiert Ridgway dem Leser in der Originalfassung: Die Geschichte von Schwester Mary Cleary, die jede Nacht von Träumen und Visionen heimgesucht wird und diese nicht zu deuten weiß; die Geschichte von einem Vater, der seinen kleinen Sohn auf einem Ausflug beinahe umbringt, ohne es zu bemerken; die Geschichte von Karl und Robert, einem deutsch-englischen Paar, das mehr mit den Sprachen als mit sich selbst zu kämpfen hat; die Geschichte eines Jungen, der herausfindet, wie es sich anfühlt zu ertrinken, und viele weitere.
Keith Ridgway schreibt mit viel Gefühl und einem feinen Sinn für die leisesten (zwischen-)menschlichen Töne. Jede seiner Geschichten wird von stillem Humor begleitet, der stellenweise schwarz, dann wieder absurd ist; jede seiner Figuren ist liebevoll gezeichnet, sympathisch und greifbar. Der Autor wagt sich an Tabuthemen heran, die jedoch in seinen Händen ihre Extreme verlieren und an Selbstverständlichkeit gewinnen, manchmal noch schockieren, ab und zu ein wenig verstören, meist aber ’nur‘ ein zustimmendes Nicken einfordern. Allen Protagonisten ist eine gewisse Verrücktheit gemein. Ihr Denken und Handeln spielt sich abseits dessen ab, was als Norm bezeichnet wird. So lässt sich zum Beispiel der alte Mann auf einer Parkbank im Gespräch mit einem Fremden sehr persönliche, intime Erinnerungen entlocken – weil es sich um ein Spiel, einen Trick oder einfach nur eine Verwechslung handeln könnte. Eine Art Wettbewerb, bei dem er nichts zu verlieren hat. Auch die Geschichten selbst weichen von der Norm ab: Verschiedenste Erzählperspektiven werden genutzt, Stil und Erzählform ändern sich oft sogar innerhalb derselben Geschichte – Ridgway probiert sich aus und tut dies mit Erfolg.
Ein wenig schwerer tut sich da die deutsche Übersetzung. Abgesehen davon, dass sie aus nicht bekannten Gründen um ganze vier Geschichten gekürzt wurde, gelingt es dem Übersetzer Jürgen Schneider nicht durchgängig, Ridgways relativ einfache, aber geschickt eingesetzte Sprache und seine treffsicheren Formulierungen zu übertragen. Die leichten stilistischen Abweichungen, wie das aus dem Englischen: „But there was a silence“ durch eine Inversion im Deutschen poetischer formulierte: „Doch war da eine Stille“, sowie kleine grammatische Auffälligkeiten zeigen, wie schwierig es sein kann, zwischen zwei Sprachsystemen zu vermitteln. Schneiders Sprache wirkt stellenweise holpriger, zergeht nicht auf der Zunge. Ratlose Männer kratzen sich beispielsweise gleich in grobem Eifer „den Kopf“, anstatt sich lediglich „am“ selbigen zu kratzen. Man stockt, wenn einem „ein den Atem nehmender Stoß“ daherkommt, der vorher ein „mouth-filling punch“ und damit viel griffiger und kompakter war. Das ist schade, aber leider im Deutschen kaum anders auszudrücken.
An vielen entscheidenden Stellen dieses Buches tendiert die Übersetzung zu mehr Eindeutigkeit. So manches Wortspiel und so manche freche Ambiguität gehen dadurch verloren: „Much was beneath her. The world as well“, in einem Moment geäußert, in dem die betreffende Person tatsächlich über der Welt schwebt, erfordert im Deutschen eine Entscheidung: „Viel war unter ihrem Niveau. Die Welt auch.“ Ebenso ist ein „Time to leave Angelo,“ das in großen Lettern und ohne Interpunktionszeichen über einen Bildschirm flimmert, schwer zu übertragen, wenn das Original im Anschluss noch auf die Zweideutigkeit des Satzes eingeht: Soll Angelo gehen oder wird jemand aufgefordert, Angelo zu verlassen?
Aufmerksam und sorgfältig geht Schneider dann aber mit der letzten Geschichte um. Sie enthält eine arg konstruiert wirkende Passage, in der die Bilder eines Künstlers beschrieben werden: Jedes Bild erinnert an eine Geschichte in Normalzeit. Diejenigen Bilder, die an die vier gestrichenen Geschichten erinnern sollen, streicht Schneider in der Übersetzung, um den Leser nicht noch weiter zu irritieren. Zudem erkennt er gut versteckte, weil nicht ausformulierte Redewendungen, „When in Rome …“ (… do as the Romans do), also „Andere Länder …“ (…andere Sitten) und wird bei Reimen kreativ, um sie angemessen übersetzen zu können: „I’m Lill. I’m Lill and I’m ill and I need a pill,“ wird zu: „Ich bin Lill. Ich bin Lill und brauch ne Pill, weil ich ja nicht krank sein will.“
Trotzdem erzeugt Normalzeit im Englischen die größere Lesefreude. Nur hier besitzen die Geschichten Leichtigkeit, sind sonderbar und beobachten die Welt, anstatt sie zu erklären.
—
Keith Ridgway: Normalzeit, aus dem Englischen übersetzt von Jürgen Schneider, Berlin: Wagenbach 2007, 233 Seiten, €19,50
Keith Ridgway: Standard Time, London: Faber and Faber 2001, 248 Seiten
Keith Ridgway wurde 1965 in Dublin geboren und lebt heute in London. 1997 erschien sein erstes Buch Horses, 1998 folgte The Long Falling. Nach der Kurzgeschichtensammlung Standard Time (2000) veröffentlichte er die Bücher The Parts (2003) und Animals.
Jürgen Schneider übersetzt aus dem Englischen. Neben „Normalzeit“ übersetzte er für den Verlag Wagenbach auch Keith Ridgways Horses (dt. Wolkenpferde).