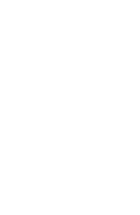In Frankreich wurde kürzlich das Vaterunser Gebet geändert, in Deutschland findet aktuell eine Debatte genau darüber statt, ob der Vers „Und führe uns nicht in Versuchung“ irreführend übersetzt sei – komme es doch nicht Gott, sondern dem Satan zu, uns zu versuchen. So lobt Papst Franziskus die französische Änderung von „Ne nous soumets pas a la tentation“ (dt.: „Unterwerfe uns nicht der Versuchung“) zu „Ne nous laisse pas entrer dans la tentation“ („Lass uns nicht in Versuchung geraten“), die zum ersten Advent dieses Jahres umgesetzt wurde. Thomas Wagner hinterfragt die Bedeutung des Verses in seinem historischen Kontext und weist auf zeitaktuelle Implikationen der päpstlichen Exegese hin.
—
Man mag sehr bezweifeln, ob Papst Franziskus den im Deutschen ja durchaus reizvollen Gedanken einer ‚Versuchung‘ im Kopf hatte, als er mit einer Bemerkung in einer italienischen Fernsehsendung en passant festhielt, die deutsche Übersetzung des Vaterunsers sei an einer Stelle schlecht: Den Deutschen vermittele die Übersetzung ja den Eindruck, Gott wäre ein Versuchender. Dabei ist es doch der Satan, der für solches verantwortlich sei, so der Papst. Der durch die deutsche Presse verbreitete Versuch des katholischen Publizisten Franz Alt, einem der wenigen Autoren, die wissen, „Was Jesus wirklich gesagt hat“ (so zumindest der Titel eines seiner Bücher, das sich mit falsch übersetzten Jesus-Zitaten befasst), die Aussage des Papstes mit dem Argument zu stützen, Jesus hätte Aramäisch gesprochen und das Original des Textes hätte „Lass retten uns aus unserer Versuchung“ gelautet, muss wohl als Scheinargument angesehen werden. Ob das Gebet überhaupt auf Jesus zurückgeht, ist mehr als umstritten. Es erscheint erst in Schriften, die mit einem Abstand von mehr als 40 Jahren zum Tode und zur Auferstehung Jesu abgefasst wurden. In den frühen christlichen Überlieferungen wird es hingegen nicht erwähnt. Damit verdreht Alt den Vorwurf des Papstes, indem er die Versuchung nicht wie Franziskus dem Satan zuweist, sondern als einen Teil der menschlichen Natur erkennt.
Dem Übersetzenden stellt sich die Frage, ob weder die eine noch die andere Deutung des Textes, die sich in der Übersetzung widerspiegeln müsste, überhaupt stimmig ist. Die Äußerung des Papstes baut immerhin auf einer redlichen Exegese des Neuen Testaments auf. Der Begriff πειρασμόν, wie er in Matthäus 6,13 erscheint, wird im Neuen Testament immer mit einer von außen auf den Menschen einwirkenden Kraft verbunden. Wiederholt wird in den Evangelien belegt, dass diese vom Satan ausgeht und Jesus dazu verleiten soll, sich von Gott zu entfernen. Damit nimmt das Neue Testament eine Tradition auf, die im alttestamentlichen Buch Hiob belegt ist. Dabei ist שׂטן ‚Satan‘ im Hebräischen jedoch kein Eigenname, sondern der Begriff bezeichnet den ‚Widersacher‘. Im Stile der in Hiob 1-2 dargestellten Szene im himmlischen Thronrat stellt er denjenigen dar, der sich gegen Gottes Güte für eine objektive Gerechtigkeit einsetzt, die von Gott ausgehen müsste. Wenn er in der Szene im Himmel in Zweifel zieht, dass Hiob den Glauben an den Gott Israels aufrechterhalten wird, wenn dieser ihn gegen Hiobs Verhalten ungerecht behandelt, soll der Satan Gott zeigen, dass objektive Gerechtigkeit und nicht subjektiv erfahrenes Heil oder Unheil den Glauben des Menschen bestimmt. Satans Behauptung wird im Buch Hiob ad absurdum geführt, indem Hiob zwar klagt und in seinem Leid das Leben mit Motiven des Todes und den Tod mit Motiven des Lebens beschreibt, seinen Glauben aber nicht aufgibt. Der Satan wird eines Besseren belehrt, gibt seinen Aktionismus jedoch nicht auf, wovon frühjüdische Schriften sowie das Neue Testament berichten. Hier wird also die Gottesbeziehung des Menschen, die sich im Glauben ausdrückt, hinterfragt: Ist es die Erfahrung von objektiver Gerechtigkeit oder die von Güte und Barmherzigkeit, zugleich aber auch von Wut und Zorn, die von Gott ausgehen können?
Nähe und Ferne Gottes sind im biblischen Sprachgebrauch Metaphern für das personale Verhältnis von Gott und Mensch. Dabei ist eine deutliche Akzentverschiebung zu erkennen: Je weiter Gott sich vom Menschen entfernt, desto größer ist das Bedürfnis des Menschen danach, dass Gott gerecht, also der Werke des Menschen entsprechend an ihm handelt. Je näher Gott dem Menschen ist, desto stärker werden die Erfahrungen von Güte, Gnade, Fürsorge und Trost empfunden. Im Vaterunser wird diese Erfahrung personaler Nähe aufgenommen. Im Vaterunser sowie in den im Kontext stehenden Anweisungen zum Fasten und zum Almosen wird die religiöse Praxis des Individuums und seine öffentliche Erscheinungsform behandelt. Der Evangelist Matthäus scheint in seiner Umwelt verschiedene Menschen vorzufinden, die ihren Glauben zu öffentlich lebten, sodass er in Matthäus 6 zu einer ritualisierten Praxis im Verborgenen rät. Die von Papst Franziskus erwähnte Bitte ist für sich genommen un-, oder wie man an seinem Kommentar sehen kann, zumindest missverständlich. Die Bitte ist in V. 13 in Form eines Parallelismus formuliert. Dieser deutet auf einen Zusammenhang zwischen der ‚Versuchung‘ und dem ‚Bösen‘ hin, wenn der Verfasser des Gebets formuliert: ‚Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen‘. Die ‚Versuchung‘ und das ‚Böse‘ werden als zwei Seiten eines den Menschen bedrohenden Geschehen verstanden. Während die ‚Versuchung‘ die Wirkung bezeichnet, beschreibt das ‚Böse‘ ihren Ursprung und zugleich die mit der Wirkung verbundene Intention. Die Bitte drückt nichts anderes aus, als dass Gott nicht der sein soll, der den Menschen versucht, sondern derjenige, der ihn von der Ursache der ‚Versuchung‘ schützt. Betrachtet man den gesamten Vers, fällt auf, dass der Kommentar des Papstes die Bedeutung marginalisiert, indem er den Terminus ‚Versuchung‘ direkt mit dem göttlichen Widersacher in Verbindung bringt und die Anrufung an Gott übergeht. Damit wird der Text entkontextualisiert.
Die Gedanken, die der Autor des Vaterunsers äußert, sind im Sinne der religionsgeschichtlichen Entwicklung innerhalb des frühen Christentums zu verstehen. Mit der Ausprägung des Monotheismus seit dem ausgehenden 6. Jahrhundert v.Chr. stellte sich für die Theologen der Folgezeiten das Problem, Kontingenzerfahrungen zu erklären: Wie sind nicht nur Sterblichkeit, sondern Krankheit, materielle Armut und Wehrlosigkeit gegenüber Aggressoren zu verstehen, wenn sie nicht durch das Wirken anderer hervorgerufen werden? Der in Jesaja 40-55 wiederholt geäußerte Gedanke der Nichtigkeit aller anderer Gottheiten wurde durch die Vorstellung eines göttlichen Hofstaates kompensiert, in dem sich die Gott dienenden, nicht-menschlichen Wesen sammeln. Ihre Rebellion gegen Gott und gegen seinen Befehl, dem Menschen als dem Ebenbild Gottes zu dienen, wurde in diesem Genre der Religionsgeschichte Israels zu einer bis heute nachwirkenden Vorstellung der nicht-göttlichen Herkunft von Leid und Todesverfallenheit des Menschen.
Die Ausführung von Papst Franziskus zeigt, wie tief die Satansfigur, die sich im Laufe der Christianisierung des Okzidents mit Teufelsvorstellungen vermischte, in das Bewusstsein der Christenheit eingedrungen ist. Der Satan wird zum Widergott erhoben, durch den das Kontingenzproblem behoben werden kann. Leid, Krankheit und Tod passen halt nicht in das Gottesbild einer Kirche, die Gott als Schöpfer, gütigen Vater und Wohltäter propagieren will. Um dieses Bild aufrechtzuerhalten, lösen sich selbst die höchsten Vertreter der römisch-katholischen Kirche vom Monotheismus und postulieren ein dualistisches Konzept, wie es im Raume theologischer Wissenschaft lange als überlebt galt. Der in der Aussage des Papstes implizierte Seitenhieb auf die vom Protestantismus geförderten landessprachlichen Übersetzungen biblischer Texte ist dabei sicherlich nicht zu überhören. Gerade der deutschsprachige Protestantismus mit seinem engen Schriftbezug, der wissenschaftlichen Sorge um die Edition der ursprachlichen Texte in kritischen Editionen und der Luther-Übersetzung als Vorbild einer mit der Reformation einsetzenden Tendenz zur Übersetzung der Bibel in Landessprachen, wird auf diese Weise vorgeführt.
Bei seinem Versuch, die deutsche Übersetzung zu konterkarieren, scheitert Papst Franziskus aber nicht nur an einem Gottesbild, das nur Teile der biblischen Botschaft über Gott umfasst, sondern auch an den Tendenzen der Postmoderne, in der die antiken Hinterlassenschaften mit einer zeitaktuellen Phänomenologie des Glaubens ins Gespräch gebracht werden, um der Fundamentalisierung des Glaubens zu wehren, an eben jenen Tendenzen zur Fundamentalisierung. Die Suche nach einem Ursprung des Übels außerhalb Gottes wird in der heutigen Zeit medial vermittelt auf fundamentale Strömungen in den anderen abrahamitischen Religionen bezogen. Die medial vermittelten Antworten unserer Zeit nach dem Ursprung des Bösen sind Bilder von Aggressoren, die im Namen einer Religion die Bevölkerung größerer Teile der Erde mit militärischer Gewalt und Terrorregimen in Angst und Schrecken versetzen. ‚Versuchungen‘ finden sich auch auf deutschen Straßen, auf denen fundamentalistische Prediger Anhänger für die eigene Sache rekrutieren. Solche fundamentalen Strömungen fördern auf beiden Seiten dualistische Gottesbilder, da die Auswirkungen des ‚Bösen‘ den Anhängern irdisch sichtbar sind.
Die Aussage des Papstes lädt aber noch zu einer weiteren Reflexion ein: Wie nehmen wir unser eigenes Leben mit Gott eigentlich wahr? Neben der Perspektive auf Gott als Versucher wäre da ja auch noch die – in der europäischen Theologie wesentlich tiefer verwurzelte – Vorstellung von Gott als dem Richter für die Deutung von ‚Versuchung‘ relevant. ‚Versuchung‘ ist Teil menschlichen Lebens, das sagt ja auch schon das Vaterunser. Es stellt sich jedoch die Frage, wie wir mit ihr umgehen. Verzeiht es uns Gott, wenn wir auf diese Weise ‚sündigen‘, erkennt er die Verfehlung als lässliche an oder wendet sich dem Menschen vergebend zu? Ein Blick in unsere direkte Umwelt reicht, um zu verstehen, was in den einzelnen Gruppen unserer Kultur als lässliches Vergehen angesehen wird. Es ist eben nicht nur die ‚zarteste‘ Versuchung, die von violettem Packpapier ummantelt in den Regalen der Supermärkte auf uns wartet und die uns als Ausflucht aus den eigentlich ‚richtigen‘ Weisen der Lebensführung vermittelt wird, sondern unter ‚Versuchung‘ werden auch all die Handlungen subsumiert, die gemeinsprachlich als ‚Kavaliersdelikte‘ angesehen werden. Auch wenn sie zum Teil rechtsstaatlicher Verfolgung unterliegen, gibt es soziologisch betrachtet in allen gesellschaftlichen Kreisen einen common sense, diese Vergehen zu marginalisieren. Es stellt sich nicht die Frage, ob solche Fehlverhalten akzeptiert werden, es gibt allein eine peer-group-abhängige und geschlechterspezifische Differenz der akzeptierten Delikte. Gerade in diesen Situationen wird Gott (zumindest sprachlich) zur richterlichen Letztinstanz, da er jenseits von Exekutive und Legislative einen Einblick in das Leben der Menschen besitzt. Man mag sich kaum vorstellen, Menschen rechneten tatsächlich damit, dass es zu einem finalen Gerichtsakt kommen wird, in dem auch dies thematisiert wird.
Der Exeget sieht bei einer solchen Interpretation von ‚Versuchung‘, wie sie in das Vaterunser hineingelesen wird, jedoch ein erhebliches Problem: Diese Deutung basiert auf einer sprachlichen Indifferenz. All diese Aspekte, die lässlichen Kavaliersdelikte, sind ‚Verlockungen‘, die dem Menschen im Laufe seines Lebens begegnen und die im Rahmen seiner Freiheit existieren müssen, damit das menschliche LEBEN auch ein MENSCHLICHES Leben ist. Die ‚Versuchung‘, von der das Neue Testament spricht, ist eine von außen kommende Kraft, die auf den Menschen einwirkt und damit nicht Teil seiner Natur, sondern ein innerweltliches Erleben ist, vor dem Gott uns schützen soll. Der Ursprung dieses Übels liegt im Dunkeln und wird in der Bibel nicht reflektiert. So ist die Äußerung des Papstes zur Übersetzung nichts anderes als eine kirchliche Exegese, die einer wissenschaftlichen Prüfung nicht standhält.
—
PD Dr. theol. Thomas Wagner lehrt als Privatdozent an der Bergischen Universität sowie der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal. Lehrstuhlvertretungen und Lehraufträge führten ihn an verschiedene deutsche Universitäten (Duisburg-Essen, Kassel, Frankfurt, Kiel). Wiederholt war er zu Forschungsaufenthalten an der Universität Lund, der Teologiska Högskolan in Stockholm und der Claremont School of Theology. Zu seinem Lehrportfolio gehört auch die Vermittlung der biblisch-hebräischen Sprache.