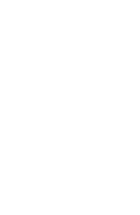Saint-John Perses Anabase ist ein einziger langer Satz, der kaum Zeit lässt, Atem zu schöpfen, der keine Zäsur zulässt; ein Strom aus Worten, der sich über die Seiten ergießt. Ein Kritiker bezeichnet das Werk zurecht als „poème en marche“, und in der Tat erinnert Perses Anabase an Xenophons Anabasis, an den darin beschriebenen langen, entbehrungsreichen „Marsch der Zehntausend“. Allerdings besteht diese Ähnlichkeit weniger auf einer inhaltlichen als vielmehr auf einer sprachlich-stilistischen Ebene: Anabase ist ein ununterbrochener Zug von tausenden Sprach-Bildern, die nur aufscheinen, um direkt wieder zu verblassen, das epische Gedicht ist permanent im Aufbruch, ständig in Bewegung. Sprachlich häufen sich im Text Verlaufsformen von Bewegungsverben, der lyrische Kosmos ist „en voyage“, „en marche“…
Doch es ist ein Aufbrechen ohne Ankommen. „The poem is a series of images of migration”, schreibt T.S. Eliot im Vorwort zu seiner Anabasis-Übersetzung. Tatsächlich stellt der Text Migration und Exil als Erfahrung der Menschheit überhaupt dar, und zwar schlicht deshalb, weil der Mensch mit Sprache umgeht, um seine Welt zu verstehen, zu erklären und zu beschreiben. Saint-John Perses Gedicht zelebriert die Erfahrung sprachlicher Fremdheit angesichts einer wirren Welt („… que ce monde est insane!“). Der Erzähler (er ist ein Fremder: „l’Étranger“) befindet sich als Abenteurer in dieser Welt, die seine eigene ist; er dringt als Pionier ins Unbetretene vor, er wird zum Eroberer, der alles Bisherige zerstört und daraus Neues schafft. Er gründet in der Wüste eine neue Stadt mit einem reinen Namen[1], nur um sie wieder zu verlassen, weiterzuziehen, vielleicht hinaus aufs offene Meer. Ebenso werden im Text Gedanken-Gebäude nur aufgebaut, um sie wieder einzureißen, und literarische Topoi – insbesondere solche aus orientalischen Sakraltexten, vor allem der hebräischen Bibel – nur zitiert, um sie sogleich wieder zu brechen: Milch und Honig fließen zwar – aber wer weiß, wo? Wer weiß, wohin? Wer weiß überhaupt irgend etwas im Dschungel der Sprachen und der Bilder?[2]
Der Sprach-Eroberer ist absolut frei – auch frei von literarischen Normen, Konventionen, Traditionen. Er lebt deshalb in selbstgewählter Einsamkeit (sein Ausruf „Solitude!“ skandiert den Text), stöbert auf den Streifzügen durch seine Sprache seltene, fremdartige Wörter auf („des voix amygdaliennes“, „un adalingue“, „l’acalyphe“), erfindet Neologismen, bewegt sich an der Grenze der ‚Verständlichkeit‘ und zeigt doch gerade dadurch den möglichen Weg hin zu einer ‚neuen‘, einer ‚anderen‘ Sprache, die über herkömmliche Begriffe hinausgeht. Doch diese Sprache bleibt unsagbar, sie manifestiert sich nicht, der Weg ist von den Wörtern der menschlichen Sprache versperrt. Saint-John Perses Poesie ist Kontemplation und Kult des Fremden. Es besteht eine unüberbrückbare Differenz zwischen Erfahrung und Empfinden, zwischen Sprache und Welt, zwischen ‚Wort‘ und ‚Ding‘. Perses Sprache zerstört das Vertraute um des Aufbruchs zum Unbekannten willen, aber vor dem Unbekannten, dem Anderen, versagt die Sprache und kann nur noch fremdartig tönen. Die Sprache wird sich selbst fremd.
Walter Benjamin entwirft zwei Jahre vor seiner Anabase-Übersetzung im Vorwort zu seinen Baudelaire-Übertragungen eine Konzeption des Übersetzens, die dieser Poetik sehr nahe steht. Allzu häufig wird Die Aufgabe des Übersetzers (1923) als ‚Übersetzungsanleitung‘ missverstanden, jedoch muss sie vielmehr als Sprach- und Übersetzungsphilosophie gelesen, verstanden und ernstgenommen werden. Benjamin gibt in seiner Vorrede keine normativen Vorgaben für ‚gutes‘ Übersetzen, sondern stellt vielmehr dar, wie die Macht und die Ohnmacht der Sprache gedacht werden können. Seine Schlüsse sind radikal und nicht selten zutiefst verstörend. So deutet er zum Ende seines Vorwortes eine „ungeheure und ursprüngliche Gefahr aller Übersetzung“ an: nämlich diejenige, „daß die Tore einer so erweiterten und durchwalteten Sprache zufallen und den Übersetzer ins Schweigen schließen.“ (IV.1, 21) Eine erweiterte und durchwaltete Sprache ist eine solche, in der „die Harmonie der Sprachen“ so tief ist, „daß der Sinn nur noch wie eine Äolsharfe vom Winde der Sprache berührt wird“ (ebd.). Die Harmonie der Sprachen, auf die die Übersetzung hinzudeuten vermag, kann, ja: muss also vom Sinn „in sehr hohem Maße absehen“ (IV.1, 18). Es geht der Übersetzung nicht um ‚Sinn‘, „also Unwesentliches“ (IV.1, 9), sondern vielmehr um die Andeutung einer Sprache, die Benjamin die „reine Sprache“ nennt – eine Sprache jenseits dessen, was mit Sprache und ihren Begriffen ‚gesagt‘ werden kann. Diese reine Sprache, „die in fremde gebannt ist, in der eigenen zu erlösen“ (IV.1, 19), bezeichnet Benjamin als die – unlösbare? – Aufgabe des Übersetzers. Da nun aber die reine Sprache unaussprechlich ist, der Übersetzer jedoch in sprechbarer Sprache spricht, herrscht hier – wie bei Saint-John Perse – eine unüberbrückbare Diskrepanz zwischen der Sprache und dem, was sie ausdrücken kann. Mit anderen Worten: die Sprache der Übersetzung muss versagen vor der reinen Sprache, auf die die Übersetzung hindeuten soll. Die Übersetzung, die Sinn anstrebt, muss scheitern, denn sie ist nichts als „eine ungenaue Übermittlung eines unwesentlichen Inhalts“ (IV.1, 9). Nur ein solcher Text – und es ist tatsächlich nur ein Text: nämlich der Heilige – ist übersetzbar schlechthin, der nicht übersetzt werden (kann und) muss, wenn der Übersetzer im Schweigen, im Versagen der Sprache vor dem, was sie ‚sagen‘ möchte, in der Interlinearversion mit dem Text verschmelzen kann.
Zwischen Saint-John Perse und seinem Übersetzer Walter Benjamin besteht eine subtile poetologische Übereinstimmung, die davon ausgeht, dass die Diskrepanz zwischen der ‚Sprache‘ und ihrem ‚Inhalt‘, zwischen ‚Wort‘ und ‚Ding‘ ein Paradigma des menschlichen Sprachhandelns überhaupt darstellt. Unter dieser Prämisse erscheint Benjamins Übersetzung von Saint-John Perse in einem anderen Licht.
Zunächst wirkt sie, wie der Herausgeber der Benjamin‘schen Anabase-Übersetzung, Rolf Tiedemann, richtig feststellt, „unzugänglich und rauh“, sie „strebt Wörtlichkeit an“ (vgl. GS Suppl. I, 451). Oft fehlt es der Übersetzung in der Tat an sprachlicher Eleganz: so umschreibt Benjamin sehr häufig Perses Adjektive oder Nomina durch Relativsatzkonstruktionen, wie etwa in Kapitel III, in denen Perses herrliche „voix amygdaliennes“ zu „Stimmen, die an Mandeln gemahnen“ werden (S. 57/ 58); oder in Kapitel X, in dem „l’acuponcteur“ überpräzise als „der mit Nadelstichen das Bauchgrimmen heilt“ (S. 75/76) übersetzt wird. Auch handfeste contresens-Fehler haben sich in seine Übertragung eingeschlichen: etwa versteht Benjamin „un enfant triste comme la mort des singes – sœur ainée d’une grande beauté“ fälschlicherweise als „ein Kind, traurig wie der Tod der Affen – ihre ältere Schwester von großer Schönheit“ (S. 62/63 – tatsächlich bezieht sich „sœur ainée“ auf „l’enfant“, und der Einschub müsste korrekt lauten: „die ältere Schwester einer großen Schönheit“). Auch den Verlegern im Insel-Verlag schien übrigens in den späten 1920er Jahren Benjamins Übersetzung so wenig gelungen, dass sie sie neu in Auftrag gaben und die deutsche Anabasis schließlich – wenn auch deutlich später, nämlich erst 1950 – in der Übertragung Bernhard Groethuysens erschien[3].
Kleinlich nach Fehlern in einer Übersetzung zu suchen, ist jedoch ein müßiges und sogar unlauteres Geschäft. Vielmehr muss man sich der viel spannenderen Frage stellen: Was tut diese Übersetzung? Wie affiziert sie die Sprache, in, mit und zwischen der sie agiert? Es ist völlig unerheblich, ob eine Übersetzung ‚gut‘ oder ‚schlecht‘ ist – in jedem Fall ist sie merk-würdig, denn es klingt und schwingt in ihr notwendigerweise – da sie sich in, zwischen und durch die Sprachen bewegt – eine Aussage über die Sprache überhaupt, ihre Möglichkeiten und Grenzen, ihre Schönheiten und Gefahren mit. So auch im vorletzten Abschnitt der Anabase, einem Ausschnitt aus Kapitel X:
[…] mais par dessus les actions des hommes sur la terre, beaucoup de signes en voyage, beaucoup de graines en voyage, et sous l’azyme du beau temps, dans un grand souffle de la terre, toute la plume des moissons! …jusqu’à l’heure du soir où l’étoile femelle, chose pure et gagée dans les hauteurs du ciel… (S. 80)
[…] aber über den Unternehmungen der Menschen auf der Erde viele Zeichen auf Reisen, viele Samen auf Reisen, und unter den Mazzoth des schönen Wetters, in einem tiefen Hauch aus der Erde, alle die Daunen der Ernten! …bis zur Stunde des Abends, wo der weibliche Stern, das reine Ding, das am hohen Himmel besoldet ist… (S. 81)
Benjamins Text stellt sich der (syntaktischen, prosodischen, lexikalischen) Fremdheit des Originaltextes, indem er diese wiederum verfremdet und damit das Thema der Fremde und des Exils zum Thema der Sprache überhaupt macht: Er fügt in einen bereits fremden Text eine noch fremdere Sprache ein, nämlich ein hebräisches Wort, indem er „l’azyme“ (wörtlich ‚das Ungesäuerte‘) als „Mazzoth“ übersetzt. Die mazzah ist das ungesäuerte Brot, das im jüdischen Ritual in der Pessach-Woche gegessen wird. Das gesamte Pessach-Fest und insbesondere der seder-Abend, der Vorabend und die Eröffnung der Festwoche, wird „Fest der ungesäuerten Brote“ genannt, denn während des Pessach-Rituals wird der Flucht der Hebräer aus Ägypten gedacht, und in der Hast der Flucht blieb nach biblischem Bericht keine Zeit, das Brot gehen zu lassen (vgl. Ex. 12,39). Es ist darüber hinaus der Gott der Hebräer, YHWH selbst, der das Pessach-Fest und das chametz-Verbot – das Verbot, in der Festwoche Sauerteig zu verzehren – festsetzt:
Ihr sollt diesen Tag haben zum Gedächtnis und sollt ihn feiern dem HERRN zum Fest, ihr und alle eure Nachkommen, zur ewigen Weise. Sieben Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen; nämlich am ersten Tage sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern tun. Wer gesäuertes Brot ißt vom ersten Tage an bis auf den siebenten, des Seele soll ausgerottet werden von Israel. (Ex. 12, 14f.; Luther)
Das Essen der mazzot zu Pessach ist demnach eine mizwah, ein Gebot, das in der Thora festgelegt ist. Es ist eine Handlung, die sich explizit auf die Heilige Schrift bezieht. Benjamins Übersetzung verweist somit in ihrer konkreten Textgestalt auf jenen Heiligen Text, dessen Interlinearversion ihm als „Urbild oder Ideal aller Übersetzung“ erscheint (IV.1, 21). Das Weiterziehen, das Wandern, die Wüste – Motive, die Perses Anabase bestimmen –, verpflanzt Benjamins Übersetzung in einen Kontext, der diesem Heiligen Text entstammt: seine Anabase ist eine Erzählung des Exodus im rituellen Erinnern – im Essen der mazzot zu Pessach (übrigens bedeutet auch das hebräische Wort pessach übersetzt „vorüber-“, „vorbeigehen“) – und somit ist der Text als ein auf heiligem Text gegründeter und deshalb übersetzbarer schlechthin legitimiert. Das Ritual der Pessach-Feier allerdings ist lediglich Zeichen des heiligen Textes, nicht heiliger Text selbst, doch in der Ausübung der mizwot durch die jüdische Gemeinde wird er sichtbar, und ist deshalb materiell gewordenes Heiliges Wort. „Viele Zeichen auf Reisen“ – der Heilige Text in seiner Befolgung, seiner Inszenierung, seiner Ausgestaltung durch das Volk der Schrift, das Volk des Gesetzes und somit des Heiligen Textes, reist in der Diaspora exiliert durch Länder und Kulturen.
Doch sind ebenso „viele Samen auf Reisen“ – es sind die Samen der reinen Sprache, von denen Benjamin im Vorwort zu seinen Baudelaire-Übertragungen spricht: demzufolge ist es die Aufgabe des Übersetzers, „in der Übersetzung den Samen reiner Sprache zur Reife zu bringen“ (IV.1, 17). Auf seinen Reisen durch die Sprachen ist dieser Same auf der Suche nach fruchtbarem Boden, um keimen und sich entfalten zu können und die Notwendigkeit der Übersetzung damit aufzuheben, sodass Originaltext und übersetzter Text einander derartig durchdringen, dass sie nunmehr in der Interlinearversion das siegreiche Verstummen des Übersetzers feiern können. Die Sprache der Übersetzung zielt darauf ab, eine Sprache sichtbar zu machen, die lediglich erahnbar, aber nicht aussprechbar ist: die reine Sprache, in der ‚Wort‘ und ‚Ding‘ unmittelbar in eins fallen, in der die Differenz, die Saint-John Perses Anabase zum Gestaltungsprinzip der Dichtung erhebt, aufgehoben sein kann. Das ‚Ding‘, das gleichzeitig ein Wort ist, ist „das reine Ding“, in dem die Unmittelbarkeit noch gegeben und nicht durch den Sündenfall des Sprachgeistes getrennt worden ist (im Hebräischen gibt es übrigens für ‚Wort‘ und ‚Ding‘ nur ein einziges Lexem: dawar). Das Fest der ungesäuerten Brote, das in Benjamins Übersetzungen mitschwingt, wird hier zu einem Fest der ungesäuerten, nämlich der „reinen“ Sprache.
—
Der deutsch-jüdische Philosoph Walter Benjamin (1892-1940) übersetzte neben Saint-John Perse vor allem Baudelaire und Proust, aber auch u.a. Balzac und Jouhandeau ins Deutsche. Sein einzigartiges Werk umfasst sprachphilosophische, geschichtsphilosophische, ästhetische und kunstsoziologische sowie literarische und literaturkritische Arbeiten.
Der französische Dichter und Diplomat Saint-John Perse (eigentlich Alexis Léger) (1887-1975) wurde auf Guadeloupe geboren und verlebte dort seine Kindheit, später verbrachte er viele Jahre im diplomatischen Dienst in China. 1960 erhielt er den Nobelpreis für Literatur für sein poetisches Werk.
Caroline Sauter hat in Paris und Düsseldorf Literaturübersetzen, deutsch-französische Kulturwissenschaft und Germanistik studiert. Sie promoviert an der LMU München über Walter Benjamin.
[1] „Ainsi la ville fut fondée et placée au matin sous les labiales d’un nom pur“, Benjamin übersetzt: „So wurde die Stadt gegründet und getan am Morgen unter den Lippenlaut eines lauteren Namens“ (S. 60/61). Benjamins Übersetzung wird hier und im Folgenden zitiert nach Walter Benjamin: Gesammelte Schriften (GS), Supplement-Band I (Kleinere Übersetzungen), hrsg. v. R. Tiedemann, Frankfurt a.M. 1999. Benjamin hat die gesamte Anabase übersetzt, erhalten sind jedoch nur sieben von zehn Kapiteln, die in GS Suppl. I mitsamt dem französischen Originaltext abgedruckt sind.
[2] „La nuit donne son lait, qu’on y prenne bien garde! Et qu’un doigt de miel longe les lèvres du prodigue…“. „Die Nacht gibt ihre Milch, davor soll man sich hüten! Und ein Finger von Honig soll an den Lippen des verlorenen Sohns entlangstreichen…“ (S. 64/65), übersetzt Benjamin.
[3] Im November 1927 schreibt der Insel-Verleger Anton Kippenberg an Benjamin, „daß der ‚Anabase‘ von Perse bei uns in einer Übertragung von Herrn Professor Groethuysen erscheinen wird“ (vgl. GS Suppl. I, 451). Die deutsche Erstübersetzung erschien allerdings schlussendlich nicht im Insel-Verlag, sondern erst 1950 in Das Lot, von folgender rätselhafter Notiz begleitet: „Mit der deutschen Übersetzung von ‚Anabasis‘ ist eine Reihe mysteriöser und eigenartiger Umstände verknüpft. […] Das Werk wurde 1929 von Bernhard Groethuysen und Walter Benjamin übersetzt.“ (vgl. GS Suppl. I, 447) Es handelt sich hier aber nicht um Benjamins Übersetzung. Rolf Tiedemann rekonstruiert aus Briefzeugnissen die Entstehung der Benjaminschen Übersetzung (die mit der im Lot abgedruckten nicht identisch ist) und ihre gescheiterte Editionsgeschichte, vgl. GS Suppl. I, 447-53.