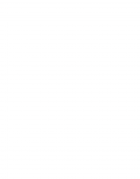Gerne werden Erkenntnis und Inspiration unmittelbar genommen, als scheine analog zur meteorologischen Metapher der Aufklärung das zu Wissende wie ein Lichtstrahl auf und ins Haupt des Denkenden, als Transversalwelle, die keiner Medien bedarf.[*] Vielleicht ist es ja auch so, doch müsste sich dann erklären lassen, wieso das zu Wissende ein so instabiles Element ist, sobald es gedacht wird, warum also das Gedachte und das Gewusste gleichsam selbst dann von einander differieren, wenn sie konvergieren. Das Gewusste ist nicht zu bannen, es ist aber vor allem das nicht von ihm zu bannen, was wie ein Mutagen auf das Gewusste wirkt. Womöglich ist das Gewusste kurzum – nicht. Es ist, jedenfalls, nicht unmittelbar. Es ist die Diversifikation (klassisch: das „διαφερόμενον έωυτώ”[1] Heraklits), die das Denken ihm zu applizieren scheint, das seinerseits also auf Begriffe baut. Und diese – surprise – sind von jener Diversifikation nicht ausgenommen, sondern nur scheinbar Sprach-Sarkophage, die bewahrend (und wörtlich das Fleisch der Sprache von den Begriffen fressend) das, was gewusst wird, von jenen Effekten isolieren.
Es gibt also Gründe – und in der Philologie ist dies am allerwenigsten abwegig –, die Sprache als Mittel der Erkenntnis, welche sich dem Schreibenden in seiner Tätigkeit wie auch dem Leser in der seinen mitteilt, ernst zu nehmen. Sieht man sie als realitäts- und möglichkeitsstiftend an, so bedeutet dies, dass die Form den Inhalt einer Mitteilung nicht nur ermöglicht, sondern ihn vor allem erschafft – sie wird er.
Dieser Gehalt ist folglich – zumal, wenn „die eigentliche Weiterentwicklung der Sprache […] an ihren Randzonen (geschieht)”[2], in der Übersetzung – im Idiom, in welchem er Wort wurde, zugleich schon bedroht. Erst recht ist zu fragen: Lassen sich diese Inhalte bewahren, wenn die Übersetzung der Form zwangsläufig grundlegend zu Leibe rückt? Bezeichnend ist ja Celans Anmerkung, ein Poem sei nicht zu übertragen, die er später im wörtlichen Sinne durchstrich: „unübersetzbar übersetzt!“[3] Die Erfahrung, ein Text sei in diesem Sinne nicht hermetisch, ist ihrerseits unzugänglich:
Hermetisches Gelingen […] hat kein Ziel, ist ohne Bedeutung. Hermetisches Gelingen ist ebenso unerklärlich, wie es alltäglich ist; ein anderes Wort dafür wäre Glück. Das hermetische Werk wird nicht geschaffen, es entsteht […]. Insofern kann es nur glücken.[4]
Das Glück freilich ist keine Größe der Aufklärung – eine „Technik des Glücks“[5] operiert mit der Schwundstufe desselben, wie es in der Sprache der Versicherungen beheimatet ist; so wirft es Fragen auf: Welche Maßstäbe lassen sich in der Praxis der Übersetzung und Übersetzungskritik behaupten? Was bewirken einem Text eingeschriebene Elemente einer anderen Sprache, sei es in Form von (vorgeblich) vorsprachlichen Einschlüssen, sei es in Form von Interferenzen?
Bilder oder in sich geschlossene Theorien (seien es die hermeneutischen der Horizontverschmelzung, sei es die sich aber schon transzendierende Rede von Nachreife) reichen kaum aus, sie fassen nicht das konkret unausgesetzte Arbeiten: weil „du glaubst, daß du mich verstanden hast, hast du damit aufgehört, mich zu verstehen“[6], schreibt Porchia. Der Fetisch des einmaligen Ausdrucks soll rational durchdacht werden – um die Sprachmystik, der die Annahme poetischer Singularität entstammt, zu analysieren und zu konkretisieren: „Das Rätsel, das es nicht nur gibt, sondern das alle unsere Seinsakte durchdringt, ist immer noch Sache der Rede“[7], so formulierte Améry einst gegen eine erklärt irrationale Mystik, das Einmalige berührt es, ohne, dass es negiert wäre, wenn es gilt, dass man „einen Text, den man übersetzt hat, […] anschließend auch im sogenannten Original anders“[8] liest.
Das ist die Utopie des Übersetzens, wenngleich nicht jede Utopie frei von Abgründen ist („Freud las […] Sophokles, danach las man nur Freud im Sophokles“[9])… Dabei versteht sich, dass diese Utopie in manchen Texten mitgedacht ist, so bei Kehlmann, der seinem Zauberroman Beerholms Vorstellung eine poetologische Kriegserklärung an die Hermeneutik voranstellt – der Text sei schon längst dort, wohin der Leser gelange. Dazu zitiert er eine alte Schrift über die Zauberei:
Solch ein Spiel verlangt Überlegung. Einem Taschenspieler zu glauben, ist Abzeichen der Dummheit. Nicht anders aber der schlichte Unglaube, den er wohl zu nutzen und gegen dich zu wenden weiß. Darum merke dir: Ihm zu mißtrauen, das ist die Weisheit der Toren. Jedoch selbst vor dem Mißtrauen noch Vorsicht zu bewahren, das ist die Torheit der Weisen. Denn aus beidem erwächst Verwirrung. Welchen Weg du auch einschlagen willst: gewinnen wird der Taschenspieler. [10]
Man ahnt, dass das Zitat ein erdachtes ist. Es ist ein Fallstrick, aus der Recherchefaulheit des Lesers und einigen gut erdachten Indizien geflochten.
Das Spiel der Übersetzung ist lesbar freilich nur im Bei-Spiel.
Übersetzung kann darin bestehen, dass ein Text in seiner Absurdität aus dem Kontext gelöst gezeigt wird, also angeklagt durch die Übersetzung der Typographie, wenn man so will. Heimrad Bäcker zeigte, wie sich das Unmenschliche des Nationalsozialismus so in Wendungen und knappsten Anordnungen kristallisiert findet:
wenn der blockschreiber irrtümlicherweise eine nummer mit dem vermerk verstorben versieht, kann solch ein fehler später einfach durch die exekution des nummernträgers korrigiert werden[11].
Das ist Übersetzungsarbeit, die gerade in der Antithese zur Intention des Autors glückt. Ähnlich lässt sich Celans Cioran-Übersetzung als Einspruch gegen dessen Fatalismus lesen, als ein Überführen, das mit den Mitteln der Literatur zugleich Verführung ist und zeigt.[12]
Übersetzung kann aber auch fast zärtlich die Fraglichkeit ihres Glückens in sich schwingen lassen, so, wenn Rose Ausländer sich selbst übersetzt oder einen (Sprach-)Klang: „Once a month/the parents took the children/to Schönbrunn./So schön!“[13] Das für englischsprachige Leser wie ein Echo aus der Ferne klingende So schön! tilgt sich selbst als ein So fern!, das kaum noch wahr, sogar kaum noch verstehbar ist; man muss vom Aufenthalt Rose Ausländers in Wien gar nichts wissen, um zu sehen, dass die Heimat nicht ungebrochenen Bestand hat.
Das kann bis zur Selbstübersetzung gehen, die Dekonstruktion ja immer sein soll, und immer lautet denn auch Pastiors Textwerdung des Textes:
das gedicht gibt es nicht. es
gibt immer nur dies gedicht das
dich gerade liest. aber weil
du in diesem gedicht siehe oben
sagen kannst das gedicht gibt
es nicht und es gibt immer nur
dies gedicht das dich gerade
liest kann auch das gedicht das
du nicht liest dich lesen und
dies gedicht hier nur immer
nicht geben. beide du und du
lesen das und dies. duze beide
denn sie lesen dich auch wenn
es dich nicht nur hier gibt[14]
Diskursiviert findet sich das in Robert Menasses Dr. Hoechst, als Raphael – der Sohn der Faustfigur Menasses – das Johannes-Evangelium, das schon bei Goethes Faust keine unwichtige Rolle spielt, übersetzt:
Es beginnt im Griechischen mit: En Arché ehn o lógos. Alles klar! Auf Deutsch: Im Anfang war das Wort. Aber nichts ist klar, wenn wir die lateinische Übersetzung dazwischen schieben: In principio principium erat. Arché ist der Anfang und principium der Anfang. Soweit korrekt. Aber auch logos kann im Deutschen als Prinzip übersetzt werden, also ist die lateinische Version, die sowohl arché als auch lógos mit principium übersetzt, ebenfalls richtig. Aber dann hieße der Satz im Deutschen: Im Prinzip war das Prinzip. Im Anfang war der Anfang. Eine Tautologie![15]
Dies ist schwerlich eine Offenbarung, so bemerkt die Figur, um dann, über weitere Polysemien stolpernd, ganz zu verzweifeln:
Logos kann auch Gerücht heißen! […] Im Anfang war das Gerücht? […] Wie konnten die Griechen philosophieren, wenn das Wort sowohl Gerücht als auch Lehrsatz sein kann?[16]
Die Übersetzung selbst mag da zum Sinn dessen werden, was zu übersetzen war. Übersetzung ruft ins Gedächtnis, was zu lesen ist – und was „zu lesen“ bedeutet. Man hört das Schillern darin, so hoffe ich: Das Lesen ist einmal auf das gerichtet, was sein Gegenstand ist, dann aber auf das, was es selbst dabei tut, wobei die Wahl des zu Lesenden und das Lesen ineinander spielen – aber auch die Frage, was Lesen sei auf die Bedeutung des jeweiligen Textes verweist.
Das heißt, dass der Originaltext immer zweierlei ist, wo er die Übersetzung – angeblich – abweist. Zum einen ist es der Fetischismus, zumal Heilige Texte nicht zu berühren, oder auch heilige Texte und solche, die heilig (nicht kursiv verstanden) sein sollen.[17] Zum anderen ist es die Priorität des Textes, die daraus in der Tat spricht, etwa, wenn dieser nicht in seiner Deutung aufgeht, die einer Übersetzung teils vorangeht, womit hier ein Limes der Übersetzung bestünde, könnte sie nicht, wie eingangs festgehalten, glücken. Die Unübersetzbarkeit kann aber auch selbst von einer Art Auftrag zeugen, etwa in der Selbstverständlichkeit, die hybride Tat und Strafe bei Ovid durch dessen Sprache aneinander zu binden scheint…
Ut tamen exemplis intellegat aemula laudis,
quod pretium speret pro tam furialibus ausis[18]…
Auf dass in Beispielen die Neiderin des Ruhmes (der Göttin) verstehe, welchen Preis sie für solch wahnwitziges Wagnis erhoffen dürfe, hierfür webt Pallas Exempel um Exempel in den Metamorphosen, in einem Wettstreit mit Arachne, die übermütig die Göttin forderte. Die neue Ebene verbürgt nicht nur, dass das, was nun geschehen soll, sozusagen Tradition hat, es legitimiert den Duktus, es könne ja gar nicht anders kommen: Arachne unterliegt und schrumpft durch Zauber, winzig wird der Kopf, von den Gliedmaßen bleiben haarfeine Beinchen, alles Übrige nimmt sich der Leib: „cetera venter habet“ [19]… Eine Spinne bleibt.
So weben Götter. Menschen dürfen im Übersetzen diese Ebenen wieder scheiden, zeigen, dass auch andere Muster möglich sind – selbst dann, wenn die Textur so bestrickend ist wie hier.
Schon und noch immer scheint dann die Übertragung gegeben zu sein, überspitzt formuliert eben: vor dem Eigentlichen, das freilich seinerseits schon „die Dislozierung des Eigentlichen“[20] ist. Das Übersetzen ist kurzum der Beginn von Sprache und dem Geschöpf, das in ihr sich auszeichnet, sich über seine Geschöpflichkeit informierend diese – und alles, was es offenbar zu wissen galt – in eine neue Gestalt bringend radikal transformiert.
Martin A. Hainz, geboren 1974 in Wien, Mag. Dr. phil., Literatur- und Kulturwissenschafter, Philosoph. Lehrtätigkeit an der Freien Universität Berlin, der Universität Wien, ferner den Universitäten von Iasi, Timisoara und Trondheim. Forschungsaufenthalte u.a. in Berlin, Boston, Düsseldorf, Hamburg, London. Humboldt-Stipendiat. Bücher: Entgöttertes Leid (2007), Lunovis ips’albumst (2007), Masken der Mehrdeutigkeit (2001, 2003), Zwischen Sprachen unterwegs (Hrsg. m. Edit Király u. Wendelin Schmidt-Dengler, 2006), Vom Glück sich anzustecken (Hrsg., 2005), Stundenwechsel (Hrsg. m. Andrei Corbea-Hoisie u. George Gutu, 2002); zahlreiche Aufsätze zur deutschen und österreichischen Literatur; Mitglied des Herausgebergremiums der historisch-kritischen Rose Ausländer-Edition (2008ff.). Derzeit mit einer Habilitation zu F. G. Klopstock befasst. (e-mail: martin.hainz@univie.ac.at / Homepage: http://homepage.univie.ac.at/martin.hainz/)
[*] Der vorliegende Text basiert auf meinem Vorwort zum Band Martin A. Hainz (Hg): Vom Glück sich anzustecken. Möglichkeiten und Risiken im Übersetzungsprozess, Wien: Braumüller 2005 (=Wiener Arbeiten zur Literatur, Bd 20)
[1] Heraklit: [Fragmente]. In: Die Vorsokratiker. Griechisch/Deutsch, übers. u. hrsg.v. Jaap Mansfeld. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 1987 (=Universal-Bibliothek Nr 10344), S.244-283, S.258, Frgm. 49.
[2] Rüdiger Görner: Lob der Grammatik. In: Merkur, Nr 638, Juni 2002, S.540-544, S.541.
[3] Notiz Paul Celans, zit. in Axel Gellhaus et. al: »Fremde Nähe«. Celan als Übersetzer. Marbach am Neckar: Deutsche Schillergesellschaft 21997 (=Marbacher Kataloge 50), S.508.
[4] Felix Philipp Ingold: „Just Make Sense. Gegen Bedeutung“. In: Bedeutung? Für eine transdisziplinäre Semiotik, hrsg. v.. Eva Waniek, Wien: Turia + Kant 2000, S.243-255, S.252.
[5] Nobert Bolz: „Some Guys Have All The Luck“. In: Lektüre. Ein Wespennest-Reader zum Welttag des Buches, hrsg.v. Walter Famler u. Bernhard Kraller, Wien: Wespennest 1999, S.70-72, S.71.
[6] Antonio Porchia: Voces Nuevas · Neue Stimmen, übers.v. Tobias Burghardt. Dürnau: Verlag der Kooperative Dürnau 1995 (Edition 350), S.41.
[7] Jean Améry: Hand an sich legen. Diskurs über den Freitod. Stuttgart: Klett-Cotta 112001, S.35
[8] Rüdiger Görner: „Zwölf Reflexionen über das Übersetzen (auch am Beispiel Paul Celans)“. In: Literatur und Kritik, Nr 373/374, Mai 2003, S.57-63, S.58.
[9] Jean Bollack: Sophokles · König Ödipus. Essays, übers.v. Jean Bollack et al. Frankfurt/M., Leipzig: Insel Verlag 1994, S.90.
[10] Daniel Kehlmann: Beerholms Vorstellung. Roman. Wien, München: Deuticke 1997, S.5.
[11] Heimrad Bäcker: nachschrift 2, hrsg.v. Friedrich Achleitner. Graz, Wien: Literaturverlag Droschl 1997 (edition neue texte), S.124.
[12] cf. Martin A. Hainz: „Übertragen – Überführen. Celan als Übersetzer Ciorans.“ In: Celan-Jahrbuch 9 (2003-2005), hrsg.v. Hans-Michael Speier. Heidelberg: Winter 2007 (=Beiträge zur neueren Literaturgeschichte, Bd 233), S.301-316, passim.
[13] Rose Ausländer: The Forbidden Tree. Englische Gedichte, hrsg.v. Helmut Braun. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag 1995 (=Fischer Taschenbuch 11153), S.210.
[14] Oskar Pastior: Das Hören des Genitivs. Gedichte. München, Wien: Carl Hanser Verlag 1997, S.16.
[15] Robert Menasse: Dr. Hoechst. Ein Faust-Spiel. Unveröffentlicht. Word-Dokument, vom Autor per e-Mail am 16.6.2009 an den Verfasser übermittelt (Kursivierungen von mir, M.H.).
[16] ibid. (Kursivierungen von mir, M.H.)
[17] cf. Andreas Mauz: „Machtworte, Macharten. Zur Pragmatik des Begriffs des ‚heiligen Textes‘ und Probleme seiner poetologischen Konturierung“. In: Heilige vs. unheilige Schrift, hrsg.v. Martin A. Hainz. Trans · Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, Nr 16/2005. ‚
[18] Publius Ovidius Naso: Metamorphosen. Lateinisch – deutsch, übers.v. Erich Rösch, hrsg.v. Niklas Holzberg. Zürich, Düsseldorf: Artemis & Winkler Verlag 141996 (Sammlung Tusculum), S.200, VI·83f.
[19] ibid., S.204, VI·144
[20] Jacques Derrida: Grammatologie, übers.v. Hans-Jörg Rheinberger u. Hanns Zischler. Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag 61996 (=suhrkamp taschenbuch wissenschaft 417), S.420.